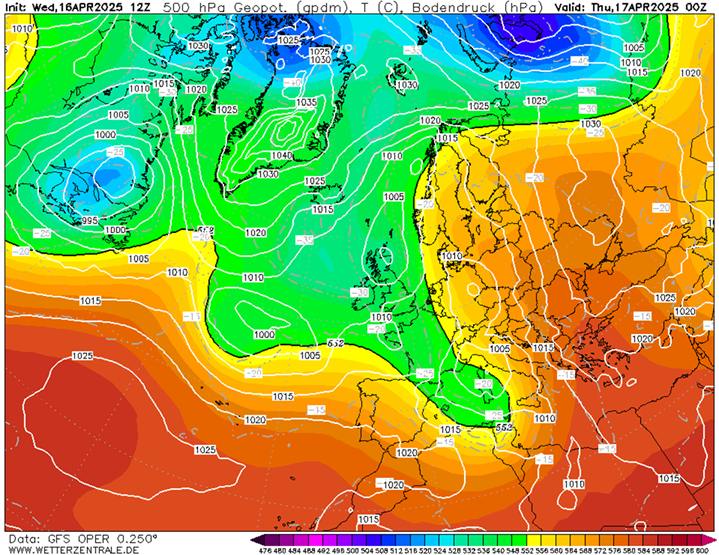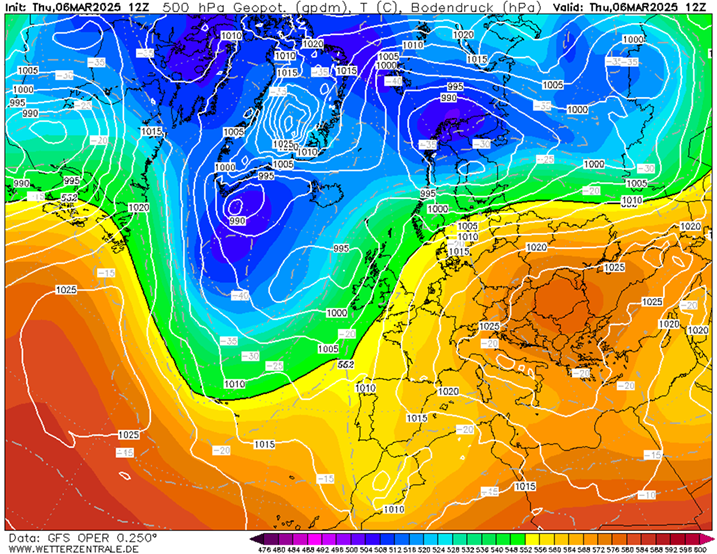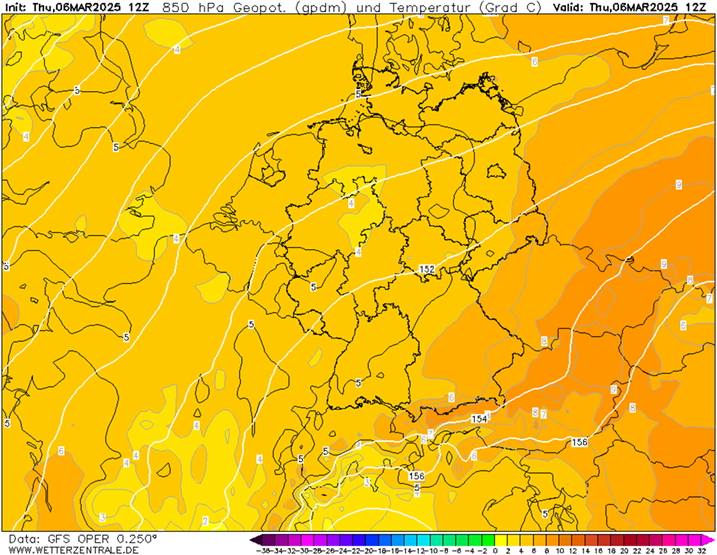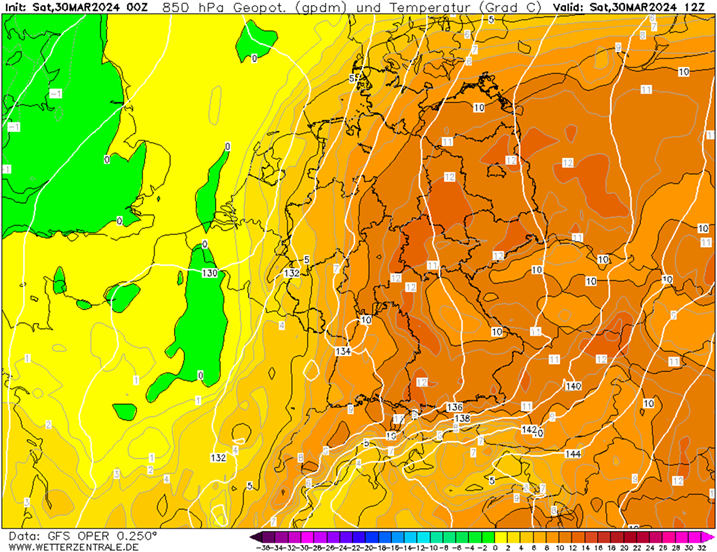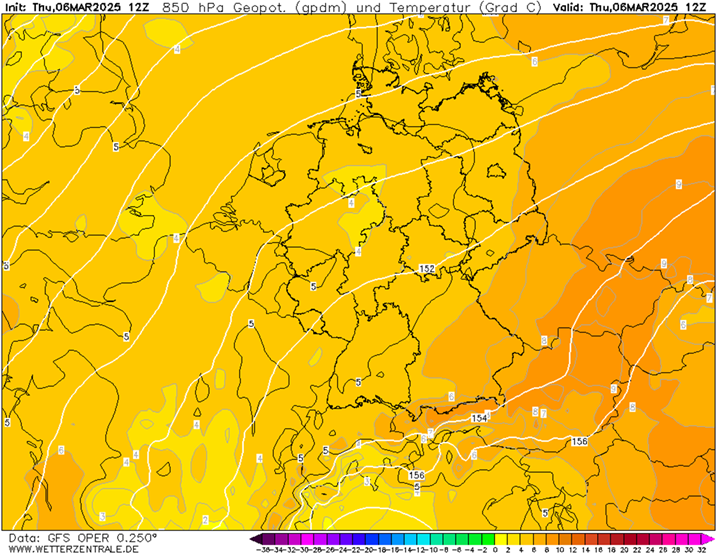| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
B E R I C H
T E |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A K T U E L L E B E R I C H T E |
|
|
| |
|
|
|
| Home |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Über uns |
|
<< Home |
>> Berichte << |
>> Archiv |
|
|
|
|
|
|
| Berichte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Galerie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Presse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dichtung |
|
Fr,
02.01.26 |
Kältester
Jahreswechsel seit 24 Jahren |
|
| Links |
|
|
| Kontakt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hintersee |
|
PROSIT 2026! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WETTER |
|
Die Wetterstation
Hintersee wünscht ein gutes neues Jahr mit den traditionellen Eindrücken
vom |
|
|
|
| Niederschlag |
|
Silvesterfeuerwerk über
der Ladenbachmetropole im Herzen der Osterhorngruppe. |
|
|
|
|
| Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prognosen |
|
Wettertechnisch verlief
der diesjährige Jahreswechsel recht ruhig. Schon der gesamte Dezember war
unter viel |
|
|
| Gewitter |
|
Hochdruckeinfluss
gestanden und brachte noch rechtzeitig zwei Tage vor Schluss eine dünne
weiße |
|
|
|
| Winter |
|
Schneedecke in unsere
Gemeinde. Zudem glitt kalte Luft aus Nordwest herbei. Am Altjahrstag zeigte
sich das |
|
|
| Buch |
|
Wetter von seiner
freundlichen und sonnigen Seite. Im Tagesverlauf kamen einige Wolken hinzu,
die von einer |
|
|
| Rekorde |
|
uns streifenden Front
stammten. Während es östlich von Salzburg entlang der Alpennordseite mit |
|
|
|
| Historisch |
|
Schneeschauern und Wind
ungemütlich wurde, schien bei uns der Mond durch die dünne Wolkenschicht und
es |
|
|
| |
|
hatte frostige
Temperaturen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit -5,7 °C genau zur
Jahreswende um Mitternacht war es heuer frostig und so kalt wie seit 24
Jahren zu diesem |
|
| |
|
Zeitpunkt nicht mehr.
Beim Jahreswechsel von 2001 auf 2002 musste man sich bei Temperaturen von
rund -10 |
|
|
| |
|
°C schon warm anziehen.
Dagegen war es von 2022 auf 2023 mit +6,8 °C regelrecht „schweißtreibend
heiß |
|
|
| |
|
gewesen“. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Fotoalbum: 01.01.26 Kältester
Jahreswechsel seit 24 Jahren |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mo,
01.12.25 |
Rückblick
November: Die zwei Gesichter des Nebelmondes |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 145,5 l/m² Niederschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 51,5 cm Neuschnee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 2,8 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 4 Eistage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der elfte Monat des
Jahres vollzog in seiner Mitte den
Wechsel vom wohligen Spätherbst hin zum Frühwinter. |
|
|
| |
|
Die erste Novemberhälfte
verlief in den höheren Tallagen oft sonnig in sehr milder Luft. Danach
stellten sich hier |
|
|
| |
|
der erste Schnee und
zeitweiliger Dauerfrost ein. In den Niederungen wechselte man dagegen vom
Hochnebel- |
|
|
| |
|
zum Wolkengrau mit
weniger milden Lichtblicken dazwischen. Wie schon der gesamte Herbst, zeigte
sich der |
|
|
| |
|
November in Niederschlag
und Temperatur am Ende recht entspannt etwas über dem langjährigen Schnitt. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am Beginn des dritten
Herbstmonats stand der Alpenraum an der Vorderseite eines Islandtiefs unter
Zufuhr recht |
|
| |
|
warmer Luftmassen. Das
Frontsystem des Tiefs drängte alsbald das Hoch über dem südöstlichen
Mitteleuropa |
|
|
| |
|
ab und brachte Regen.
Dahinter baute sich rasch von Südwesten her neuer Hochdruck im Vorfeld
des |
|
|
| |
|
ehemaligen Hurrikans
„Melissa“ auf, der über dem nördlichen Atlantik langsam ins Nirvana driftete.
In schwacher |
|
|
| |
|
Höhenströmung stellte
sich hierzulande eine typische Inversionslage ein. Rund um den ersten
Dekadenwechsel |
|
|
| |
|
glitt der Hochdruck mit
seinem Kern nach Osteuropa ab und ein Höhentief aus dem Mittelmeerraum wurde
an |
|
|
| |
|
dessen Südwestflanke um
den Ostalpenraum herumgeführt. Ein weiteres Höhentief strich an der Nordseite
eines |
|
| |
|
westeuropäischen
Hochkeils hinweg. Wieder neigte das Wetter zur Inversion. Zur Monatsmitte
belagerte ein |
|
|
| |
|
Trog mit Tiefdruck über
den Britischen Inseln und der Biscaya den Kontinent. Bei uns etablierte dies
eine |
|
|
| |
|
südwestliche
Höhenströmung, mit der hochsommerlich anmutende Subtropikluft samt etwas
Saharastaub |
|
|
| |
|
advehiert wurde. Die
Temperatur stieg in 1.500 m auf +17 Grad. Mangels eines richtigen
Föhndurchbruchs und |
|
|
| |
|
der tiefstehenden Sonne
konnte sich die Qualität der Luftmasse nicht nach unten durchsetzen. Mit dem
Kopf |
|
|
| |
|
durch die Wand wollte
schließlich polare Kaltluft nach der ersten Novemberhälfte. Zwischen einem
Islandhoch |
|
|
| |
|
und einem Baltikumtief
wurde sie erfolgreich in den Alpenraum geschoben. Ein Nordseetief samt
Ablegertief über |
|
| |
|
Italien sorgte für
neuerliche Niederschläge. Die eingeflossene Kaltluft kam nach Schwenk in die
dritte |
|
|
| |
|
Novemberdekade zur Ruhe
und konnte unter einem Azorenhochkeil auskühlen. Es herrschte an den
Morgen |
|
|
| |
|
mäßiger bis strenger
Frost. Die letzte Novemberwoche wurde von einem Nordseetief eröffnet, das
über |
|
|
| |
|
Norddeutschland hängen
blieb. AN seiner Rückseite strömte erneut Kaltluft in den Mittelmeerraum,
wodurch es |
|
|
| |
|
zu wiederholten
Niederschlägen durch Italientiefs kam. Das erste Adventwochenende stand unter
antizyklonalem |
|
| |
|
Einfluss, der von der
kaum wetteraktiven Warmfront eines Nordmeertiefs unterbrochen wurde. Mit der
Front kam |
|
|
| |
|
es vor allem in der Höhe
zu einer deutlichen Milderung. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Den inversiven Kontrast
bei den Temperaturen sah man auch in der Monatsbilanz für Österreich. Trotz
der kalten |
|
| |
|
zweiten Hälfte fiel der
November auf den Bergen um 0,5 °C leicht zu mild aus. Dagegen betrug die
Abweichung |
|
|
| |
|
in den Tallagen -1 °C im
Vergleich zur aktuellen Normalperiode 1991-2020. Im Verhältnis zum
Referenzmittel |
|
|
| |
|
1961-90 wiesen sowohl die
Tallagen mit +0,2 °C als auch die Berge mit +1,6 °C ein Plus auf. Die
Stationen auf |
|
|
| |
|
der Loferer Alm (1.623 m;
Mittel: 2,5°C, Abw.: +0,7 °C) und am Feuerkogel (Oberösterreich, 1.618 m;
Mittel: 2,0 |
|
|
| |
|
°C, Abw.: +0,6 °C)
schafften es unter die relativ mildesten Plätze in Österreich. In Salzburg
gab es die höchste |
|
|
| |
|
Monatsmitteltemperatur
mit 4,5 °C am Kolomansberg (1.114 m), wo sich mit 20,5 °C am 13. November
zudem |
|
|
| |
|
das wärmste Tagesmaximum
des Bundeslandes ereignete. Am kältesten war es in Salzburg ebenso auf
einem |
|
|
| |
|
Gipfel. Und zwar jenem
des Sonnblicks (3.105 m) mit -20,6 °C am 22. November. Zu den relativen
Spitzenreitern |
|
| |
|
zählten Salzburger Orte
ebenfalls bei der Sonnenscheindauer. Zell am See (118 Stunden, Abw.: +92 %)
und |
|
|
| |
|
Krimml (70 Stunden, Abw.:
+89 %) waren hier ganz vorne mit dabei. Generell waren die Regionen von |
|
|
| |
|
Vorarlberg bis in den
Südosten sowie nördlich der Alpen bis Niederösterreich mit Überschüssen von
verbreitet |
|
|
| |
|
bis zur Hälfte, lokal bis
knapp des Doppelten des Solls im November die sonnigsten in Österreich. Im
Nordosten |
|
|
| |
|
schien die Sonne immerhin
noch bis zu einem Viertel öfter. Im nördlichen Waldviertel auch bis zur
Hälfte mehr. |
|
|
| |
|
Eine ausgeglichene Bilanz
wiesen die Nebelregionen in Oberösterreich auf. Bundesweit betrug das
Sonnenplus |
|
|
| |
|
33 %. Es war einer der 15
sonnigsten in der österreichischen Messreihe. Sonnenreichster Platz war mit
171 |
|
|
| |
|
Stunden die Villacher
Alpe (Kärnten). Nach Kärnten ging mit dem Loiblpass und 256 l/m²
Niederschlag |
|
|
| |
|
außerdem der Siegerpokal
für den nassesten Ort Österreichs. Über weite Teile des Bundesgebiets zeigte
sich |
|
|
| |
|
der November ausgeglichen
feucht. Zugewinne bis zur Hälfte erzielte der Nordosten, lokal im
nördlichen |
|
|
| |
|
Waldviertel sammelte sich
knapp das Doppelte. Dafür blieb es vom Tiroler Oberland bis Oberkärnten
zwischen |
|
|
| |
|
einem und zwei Drittel zu
trocken. Österreichweit war der November schlussendlich mit -5 % Abweichung
beim |
|
|
| |
|
Niederschlag nur marginal
unterdurchschnittlich. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Hintersee
präsentierte sich der November mit einer Niederschlagsmenge von 145,5 l/m²
bei einer Abweichung |
|
| |
|
von +19 % etwas feuchter
als im Mittel. Der Niederschlag verteilte sich dabei auf 12 Niederschlagstage
(-1 Tag) |
|
|
| |
|
und damit gleich viel wie
im Vorjahr. Der nasseste Tag war der 17. November mit 34 l/m² aus einer
Regen- und |
|
|
| |
|
Schneekombination. Dafür
blieb es vom 4. Bis 8. Und vom 12. Bis 16. November jeweils 5 Tage
hintereinander |
|
|
| |
|
trocken. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Löwenanteil des
Niederschlags entfiel auf den Regen, wobei dieser am 17. November mit der
größten |
|
|
| |
|
Tagesmenge von 30 l/m²
sein Wirken für diesen Monat einstellte. Mit -9 % landete der heurige
November genau |
|
|
| |
|
in der Mitte unserer
Messreihe. Es gab 6 Regentage (-4 Tage). Gemeinsam mit 2024 und 2018 die |
|
|
|
| |
|
zweitwenigsten. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ebenso mittelmäßig
präsentierte sich der November beim Neuschnee mit einer Summe von 51,5 cm bei
einem |
|
|
| |
|
Minus von 14 %. Am
meisten schneite es mit 15 cm am 25. November. Es war einer von gesamt 7 |
|
|
|
| |
|
Schneefalltagen (+1 Tag).
Die Monatsmenge reichte jedoch, um vom ersten Schneefall des Winters am
17. |
|
|
| |
|
November bis zum
Monatsende eine 14-tägig geschlossene Schneedecke an unserer Station zu
halten. Ihren |
|
|
| |
|
Höhepunkt erreichte sie
mit 22 cm am 26. November. Es war die längste Schneedeckendauer in einem |
|
|
| |
|
November seit 2017. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bei den Temperaturen
schaffte der November die fast perfekte Zweiteilung. Da der Wetterumschwung
erst am |
|
|
| |
|
17. November kam, suppte
die recht milde erste Monatshälfte noch ein Stück weit in die markant zu
kalte zweite |
|
|
| |
|
Novemberhälfte hinein.
Eine Abweichung von -1,5 °C in der zweiten Monatshälfte reichte aus, um diese
zur |
|
|
| |
|
kältesten zweiten
Halbzeit seit 2010 (Abw.: -2 °C) zu machen. Betrachtet über den ganzen Monat
lag der |
|
|
| |
|
November mit einer
Abweichung von +0,2 °C bei einer Mitteltemperatur von 2,8 °C sehr nahe am
langjährigen |
|
|
| |
|
Schnitt und damit
selbstredend im Mittelfeld unserer Messreihe zwischen den Novembern 2002
(Mittel: 2,9 °C) |
|
|
| |
|
und 2010 (Mittel: 2,7
°C). Das höchste Tagesmaximum erzielten wir mit 15,5 °C gleich am 1.
November. Am |
|
|
| |
|
tiefsten sank das
Thermometer mit -9,7 °C am 23. November. Es war das niedrigste Tagesminimum
im |
|
|
| |
|
November seit 12 Jahren
und das zehntkälteste eines Novembertages in der heimischen Messhistorie.
Wir |
|
|
| |
|
zählten heuer 4 Eistage
(+1 Tag), 12 Frosttage (-2 Tage) und 18 kalte Tage (-4 Tage). Die Anzahl der
Eistage |
|
|
| |
|
war seit 2013 nicht mehr
so hoch. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Tateinheit mit dem
Novemberende ging auch der meteorologische Herbst, bestehend aus den
Monaten |
|
|
| |
|
September, Oktober und
November, vorbei. Dieser benahm sich heuer relativ unauffällig. Nach den |
|
|
|
| |
|
Wärmeeskapaden der
vergangenen 3 Jahre sank die gemittelte Temperatur des Herbstes im Jahr 2025
bei uns |
|
| |
|
in Hintersee auf 7,6 °C
ab. Mit einer Abweichung von +0,4 °C war der heurige Herbst ein
Mittelständler und |
|
|
| |
|
gleich temperiert wie
sein Vorgänger aus 2021. Der September fiel noch zu warm aus, während Oktober
und |
|
|
| |
|
November durchschnittlich
schlossen. Die Niederschlagssumme belief sich auf 533 l/m² und lag 7 % im
Plus. |
|
|
| |
|
Über alle drei Monate
verteilte sich der Niederschlag durchaus gleichmäßig, wobei der Oktober einen
etwas |
|
|
| |
|
größeren Anteil hatte.
Die Anzahl an Regen- und Schneefalltagen bewegte sich mit 36 bzw. 7 (jeweils
-1 Tag) |
|
|
| |
|
am langjährigen Normal. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Das Bundesland Salzburg
landete bei Temperatur und Sonnenscheindauer im Herbst 2025 eine Abweichungs- |
|
|
| |
|
nullnummer. Einzig an
Niederschlag akkumulierten sich um 12 % weniger als im Soll. Sonnigster Platz
war der |
|
|
| |
|
Sonnblick mit 450
Stunden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Herbstbilanz für
Österreich hatte genauso keine Ausreißer zu bieten. AM engsten am
langjährigen Mittel der |
|
|
| |
|
Jahre 1991-2020 lag die
gemittelte Temperatur mit einer minimalen Abweichung von +0,1 °C. Im
Vergleich zum |
|
|
| |
|
Klimamittel 1961-90 gab
es dann unterschiedliche Abweichungen. Diese betrugen in den Tallagen +0,8 °C
und |
|
|
| |
|
auf den Bergen +0,5 °C.
In der Messhistorie Platz 43 bzw. 39. Der heurige Herbst war damit ident
temperiert wie |
|
| |
|
der aus 2021. Die Sonne
strahlte um magere 3 % weniger als üblich. Am längsten mit 509 Stunden
am |
|
|
| |
|
Brunnenkogel (Tirol).
Beim Niederschlag fiel das Defizit mit -10 % zwar etwas größer, aber dennoch
innerhalb |
|
|
| |
|
der normalen
Schwankungsbreite aus. Niederschlagsreichster Fleck war der Loiblpass mit 601
l/m². |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Herbstvergleich |
>> Herbstvergleich Temp. |
|
| |
|
|
>> Monatsrangliste Niederschlag |
>> Tagestemperaturen |
>> Klimatage |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Monatsvergleich Temp. |
>> Winterstatistik |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
So,
23.11.25 |
Kältester
Novembertag seit 12 Jahren |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Vorzeichen für einen
eisigen Sonntag standen gut und konnten an unserer Station zum kältesten |
|
|
|
| |
|
Novembertag seit 2013
umgemünzt werden. Frischer Neuschnee, eingeflossene polare Kaltluft und
ein |
|
|
| |
|
Aufklaren über Nacht
waren die entsprechenden Zutaten für einen richtigen Wintertag. Tagsüber
strahlte die |
|
|
| |
|
Sonne, die Temperaturen
blieben im Frostbereich bis sie am Abend aufgrund einer Warmfront
allgemein |
|
|
| |
|
anstiegen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Zwischenhoch nach
Schneetiefs |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Unter der Woche fiel der
erste Neuschnee der heurigen Wintersaison. Ein Tief-Doppel über Skandinavien
und |
|
|
| |
|
der Adria ließ die
Schneedecke an unserer Messlatte auf 15 cm steigen. Zum Wochenende hin
verließ der Trog |
|
|
| |
|
mit den beiden Tiefs den
Alpenraum ostwärts und an seiner Rückseite glitt polare Kaltluft aus
nördlicher Richtung |
|
| |
|
herbei. AM Samstag hielt
sich dabei noch eine mehr oder weniger dicke Dunstschicht, die sich in der
Nacht zu |
|
|
| |
|
Sonntag vollends
auflöste. Damit stand vor allem in den schneebedeckten Tälern eine
makellose |
|
|
|
| |
|
Strahlungsnacht bevor, in
der es ungehindert auskühlen konnte. Geschuldet war dies einem von
Südwesten |
|
|
| |
|
heranrückenden Hochkeil,
der am Sonntag wetterbestimmend wurde. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Niedrigstes
Novemberminimum seit 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit einem Tiefstwert von
-9,7 °C um halb acht Uhr morgens war es an unserer Station in Hintersee
das |
|
|
| |
|
niedrigste Minimum eines
Novembertages seit den -10,6 °C vom 28. November 2013. Zugleich schaffte es
der |
|
|
| |
|
heutige Sonntag auch in
die Top 10 der kältesten Novembertage unserer Messreihe (seit 2002). Alle
anderen |
|
|
| |
|
Einträge stammten aus
den Jahren 2001, 2005, 2008, 2010 und eben 2013. Am eisigsten war es mit -12
°C am 25. November 2005. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die 10 kältesten
Novembertiefstwerte |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
25.11.2005 |
-12,0 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
24.11.2005 |
-11,0 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
30.11.2010 |
-10,7 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4 |
28.11.2013 |
-10,6 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5 |
23.11.2005 |
-10,5 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6 |
27.11.2013 |
-10,1 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7 |
15.11.2001 |
-10,0 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
29.11.2005 |
-10,0 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
23.11.2008 |
-10,0 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10 |
23.11.2025 |
-9,7 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Strenger Frost im
November früher normal |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Im November geht es aber
noch zapfiger, wie uns die Daten seit den 1960ern an der Hydrografischen
Station in |
|
|
| |
|
Faistenau verdeutlichen.
Das absolute Novemberminimum ereignete sich hier mit -17,3 °C am 23.
November |
|
|
| |
|
1988. Am 22. November
1998 sank das Thermometer auf -16,5 °C und am 26. November 1989 immerhin auf
– |
|
|
| |
|
15,9 °C. Zweistellige
Minima kamen im November außerdem in den Jahren 1965, 1971, 1972, 1975, 1977,
1981, |
|
| |
|
1983, 1985, und 1999 vor.
In manchen Jahren sogar mehrfach. Ein Auftreten von strengem Frost war somit
in |
|
|
| |
|
früheren Jahrzehnten
relativ normal und ist erst in den letzten 1 ½ Jahrzehnten rar geworden. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Kältepole in Tirol,
Salzburg und OÖ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Eisschrank der Nation
wurde mit -20,1 °C nach Tannheim (Tirol) geliefert. Ausgenommen Salzburger
Orte, |
|
|
| |
|
reihten sich dahinter
Liebenau/Gugu mit -17,2 °C (Oberösterreich) und Ehrwald mit -16,3 °C (Tirol)
ein. |
|
|
| |
|
Dazwischen lagen aber
bereits die eisigsten Salzburger Gemeinden, die von Zell am See mit -17,8 °C,
St. |
|
|
| |
|
Michael mit -17,3 °C und
Radstadt mit -17,1 °C angeführt wurden. Tamsweg (-16,2 °C) und Rauris (-15,8
°C) |
|
|
| |
|
schafften es ebenfalls
noch in die österreichweiten Top 10. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bad Hofgastein (-13,6
°C), Krimml (-13,3 °C), Abtenau (-11,9 °C), St. Veit (-10,9 °C und St. Johann
(-10,4 °C) |
|
|
| |
|
waren ebenso mit
zweistelligen Minusgraden dabei. Die mildesten Minima gab es in Mattsee (-7,7
°C), der Stadt |
|
| |
|
Salzburg (-8 °C), im
benachbarten St. Wolfgang (-8,1 °C) und in Lofer (-8,6 °C). |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Auf den Bergen wies der
Sonnblick (3.105 m) mit -18,1 °C den Tiefstwert auf. Dahinter folgten die
Rudolfshütte |
|
|
| |
|
(2.304 m) mit -16,9 °C
und die Schmittenhöhe (1.973 m) mit -13,1 °C. Am Feuerkogel (1.618 m,
Oberösterreich) |
|
| |
|
waren es -11,6 °C, auf
der Loferer Alm (1.623 m) -10,6 °C und am Kolomansberg (1.114 m) -9,1 °C. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle:
www.austrowetter.at, wetter.orf.at |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagestemperaturen |
>> Winterstatistik |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Fr,
31.10.25 |
Rückblick
Oktober: Die graue Allerwelts-Herbstmaus |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 216 l/m² Niederschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 67 l/m² höchste
Tagesregenmenge |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 7,2 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 12 trockene Tage am
Stück |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Wer heuer auf einen
goldenen Oktober hoffte, wurde aufgrund des historisch hohen Feinunzenpreises
jäh |
|
|
| |
|
enttäuscht. Die Wälder
trieben ihr allherbstliches Farbenspiel, die Berge versuchten es mit dem
ersten Weiß, |
|
|
| |
|
jedoch der Himmel bestand
meistens auf ein schlichtes Grau. Der fehlende Sonnenschein, Wolken,
Hochnebel |
|
|
| |
|
und Wind verpassten dem
heurigen Oktober ein etwas tristes Antlitz. Es gab um ein Drittel mehr Regen
und |
|
|
| |
|
dazwischen eine knapp
2-wöchige Trockenphase. Nach den Wärmeeskapaden der letzten drei Jahre
plumpste |
|
|
| |
|
der Oktober auf ein
normales Temperaturniveau ab. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Oktober fing
hochdruckgeprägt an. Eine kräftige Antizyklone thronte über Nordwestrussland,
wobei der |
|
|
| |
|
Rücken von den Azoren bis
zum Kaspischen Meer reichte. Der Alpenraum wurde dabei ganz zu Anfangs
von |
|
|
| |
|
einem Höhentief über
Osteuropa gestreift. Nach ein Paar trockenen Tagen mischte der ehemalige
Hurrikan |
|
|
| |
|
„Humberto“ als
außertropisches Orkantief über den Britischen Inseln das Geschehen auf. Mit
ihm wurde die Mitte |
|
| |
|
der ersten Oktoberdekade
recht nass und frisch mit Schnee auf rund 1.000 m herab. Lokal sank die |
|
|
|
| |
|
Schneefallgrenze im
oberen Lammertal sogar bis zum Talboden. Es folgte ein weiteres von den
Briten nach |
|
|
| |
|
Skandinavien wanderndes
Tief, das eine feuchte Woche in nordwestlicher Strömung fortsetzte. Dahinter
baute |
|
|
| |
|
sich allerdings schon ein
Hoch über dem Ostatlantik auf, welches zum Dekadenwechsel über
Mitteleuropa |
|
|
| |
|
hinweg südostwärts
auskeilte. Das Mitteldrittel des Oktobers stand nun vollends unter dem
blockierenden Hoch |
|
|
| |
|
über den Britischen
Inseln. Die Frontalzone wurde nordwärts abgelenkt, jedoch gelangte in
nördlicher Strömung |
|
|
| |
|
kühle Luft in den
Alpenraum. So verging die meiste Zeit der Hochdruckdominanz in den
Niederungen unter |
|
|
| |
|
Hochnebel. Mit dem
Wechsel in das finale Oktoberdrittel setzte sich das Blockadehoch nach
Südosteuropa in |
|
|
| |
|
Bewegung und im Vorfeld
sich nähernden Tiefdrucks drehte die Strömung auf Südwest. Es kam zu den |
|
|
| |
|
mildesten Tagen im
Oktober. Die kurze Föhnepisode wurde von einem Schottlandtief beendet, dessen
Randtief |
|
|
| |
|
über dem Ärmelkanal sich
zum Sturmtief aufschwang und eine markante Kaltfront in den Alpenraum
lenkte. |
|
|
| |
|
Stürmischer Westwind
brachte kühle Luft und es schneite ein zweites Mal auf den Bergen. Das
letzte |
|
|
|
| |
|
Oktoberwochenende stand
noch im Zeichen des nach Skandinavien weitergewanderten Tiefkomplexes, dem
ein |
|
| |
|
Tief bei den Britischen
Inseln folgte. Windiges Nordwestwetter mit wiederholten Fronten sorgten für
eine zweite |
|
|
| |
|
Regenphase diesen Monat.
Am Oktoberende setzte sich von Südwesten her zögernd Hochdruck durch und
es |
|
|
| |
|
wurde milder. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Auffällig unauffällig
waren diesen Oktober in Österreich die Temperaturen. Bundesweit gemittelt lag
der zweite |
|
|
| |
|
Herbstmonat in den
Niederungen um 0,3 °C unter der aktuellen Klimanormalperiode 1991-2020 und
damit |
|
|
| |
|
erstmals nach 3 Jahren
mit ungewöhnlichen Wärmeanomalien wieder recht gut beim Schnitt. Auf den
Bergen |
|
|
| |
|
betrug die Abweichung
sogar -1,5 °C, was hier den kühlsten Oktober seit 2016 bewirkte. Mit
Abweichungen von – |
|
| |
|
2,1 °C lagen die Loferer
Alm (1.623 m, Mittel: 4,0 °C) und der Feuerkogel (Oberösterreich, 1.618 m,
Mittel: 3,4 |
|
|
| |
|
°C) im Negativbereich
voran. Im Vergleich zum Referenzmittel 1961-90 gab es Abweichungen von +0,4
bzw. -1,3 |
|
| |
|
°C. Kuriosum am Rande:
Für das Bundesland Salzburg wurde die höchste Tagestemperatur diesen Oktober
in |
|
|
| |
|
St. Michael (1.052 m)
mit 20,3 °C am 11. Oktober erzielt. Beim Niederschlag fehlte österreichweit
ein Viertel des |
|
| |
|
Üblichen. Dies lag vor
allem an ausbleibender Tiefdrucktätigkeit im Mittelmeerraum, die im Herbst
normalerweise |
|
| |
|
die Alpensüdseite mit
Wasser versorgt. Entlang des Alpenhauptkamms von Tirol bis in die Steiermark
sowie |
|
|
| |
|
südlich davon waren die
Defizite zwischen einem Drittel und drei Viertel am größten. Bis zu einem
Drittel weniger |
|
| |
|
gab es im Osten. Meist
ausgeglichen präsentierte sich die Alpennordseite. Vom Flachgau bis zur
Eisenwurzen |
|
|
| |
|
erregnete sich der
Oktober jedoch Zugewinne bis zur Hälfte des Solls. Nassester Platz war die
Rudolfshütte mit |
|
|
| |
|
177 l/m². Die Sonne
lachte der Alpenrepublik um 17 % seltener. Damit war es der sonnenärmste
Oktober seit |
|
|
| |
|
2020 (Abw.: -29 %). Den
größten Sonnenmangel gab es dabei in einem Streifen vom Tennengau und
dem |
|
|
| |
|
Salzkammergut bis zum
Mühlviertel mit Einbußen bis gut der Hälfte. Bis zu einem Drittel weniger
Sonne gab es |
|
|
| |
|
zudem im restlichen
Oberösterreich, und von der Obersteiermark bis Niederösterreich. Sehr sonnig
mit bis zu |
|
|
| |
|
einem Drittel mehr an
Sonnenstunden war es in Osttirol und Oberkärnten. Der große Teil dazwischen
lag um das |
|
| |
|
langjährige Mittel bzw.
leicht darunter. Sonnenreichster Ort war Lienz (Tirol) mit 180 Sonnenstunden.
Am relativ |
|
|
| |
|
trübsten blieb es am
Feuerkogel und der Stadt Salzburg mit einem Minus von 54 %. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Niederschlagsbilanz
in Hintersee fiel im Oktober mit 216 l/m² um 24 % überdurchschnittlich aus.
Der heurige |
|
| |
|
Oktober war damit gleich
nass wie jener aus 2011. Es gab genau im Mittel liegende 14
Niederschlagstage. Vom |
|
| |
|
11. Bis zum 22. Oktober
ereignete sich eine 12-tägige Trockenperiode, welche die längste seit 2018
war, die |
|
|
| |
|
durchgängig in einem
Oktober auftrat. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Oktober blieb
gewitter- und schneefrei. Zum fünften Mal in Folge schaffte der Oktober
keinen Neuschnee- |
|
|
| |
|
gruß mehr bis ins Tal.
Seit 2015 hat es ohnehin nur noch zweimal (2016 und 2020) die Minimalmenge
von je |
|
|
| |
|
einem Ehrenzentimeter
gegeben. Zuvor gab es im Oktober immer wieder verlässlich den ersten Schnee
im Tal. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Demnach akkumulierte sich
der Monatsniederschlag erneut rein aus dem gefallenen Regen und ein paar |
|
|
| |
|
Graupelkörnern. In dieser
Statistik lag das Plus bei 33 %, was ex aequo mit dem Oktober 1998 immerhin
den 8. |
|
|
| |
|
Platz bedeutete. Zuletzt
mehr Regen gab es 2020 (235 l/m²). Wir zählten 14 Regentage (+1 Tag) und
damit |
|
|
| |
|
genau so viele wie im
vorigen Oktober. Die größte Tagesmenge regnete es mit 67 l/m² am 6. Oktober.
Zugleich |
|
|
| |
|
war dies die
sechsthöchste Regenmenge, welche es an einem Oktobertag gab. An den 3 Tagen
vom 5. Bis zum |
|
| |
|
7. Oktober fiel mehr als
die Hälfte der Monatssumme. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit einer gemittelten
Temperatur von 7,2 °C bei einer Abweichung von -0,5 °C war der Oktober nach
drei |
|
|
| |
|
Rekordjahren
hintereinander wieder einmal ein durchschnittlicher Geselle. Er platzierte
sich damit im unteren |
|
|
| |
|
Mittelfeld. Die erste
Dekade war markant zu kühl, die beiden weiteren Monatsdrittel bewegten sich
im |
|
|
| |
|
langjährigen Schnitt.
Letztmals kühler war es im Oktober 2016 (7,0 °C). Danach ereigneten sich von
2017 bis |
|
|
| |
|
2024 drei sehr warme und
drei extrem warme Oktober, die den subjektiven Eindruck ins Abnormale |
|
|
|
| |
|
verwässerten und den
diesjährigen kühl wirken ließen. Die höchste Tagestemperatur wurde mit 16,7
°C am 21. |
|
|
| |
|
Oktober gemessen. AM
tiefsten Sank das Thermometer mit 0,9 °C am 3. Oktober. Es traten einige Male
Boden-, |
|
| |
|
aber kein Luftfrost auf
(-3 Frosttage). Zudem zählten wir durchschnittliche 9 kalte Tage, die meisten
seit 2020 (12 |
|
| |
|
kalte Tage). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Tagestemperaturen |
>> Winterstatistik |
|
| |
|
|
>> Tagesrangliste Regen |
>> Monatsvergleich Temp. |
|
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Klimatage |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Di,
07.10.25 |
Erster
Bergschnee mit nassem Oktobertag |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit einem Kaltluftvorstoß
im Rücken eines Orkantiefs wurde es dieser Tage erstmals im heurigen Herbst
auf |
|
|
| |
|
unseren Bergen weiß. Der
Winter grüßte kurz bis in die Niederalmen herab, im Tennengau schneite es
lokal |
|
|
| |
|
sogar bis ins Tal. In
Hintersee blieb es herunten bei flüssigem Niederschlag, der am Montag
immerhin die |
|
|
| |
|
sechstgrößte Regenmenge
eines Oktobertages brachte. Wolkenverhangener Himmel und frischer
Nordwestwind |
|
| |
|
machten die trübe
Herbststimmung perfekt. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ex-Hurrikan wird zum
Orkantief |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ausgangspunkt des
Ereignisses war der ehemalige Tropensturm „Humberto“, der in den Tagen zuvor
unter |
|
|
| |
|
deutlicher Abschwächung
seinen Weg über den Nordatlantik angetreten hatte. Dort erfuhr das
Druckminimum |
|
|
| |
|
durch einen
Kaltluftvorstoß bei Grönland neues Leben. Sich zum außertropischen Orkantief
verstärkend, zog das |
|
| |
|
nunmehrige Tief „Detlef“
bis Samstag in Richtung Schottland. Seine Kaltfront erreichte am Samstagabend
den |
|
|
| |
|
Alpenraum. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In weiterer Folge setzte
„Detlef während des Sonntags, in südöstlicher Richtung die Nordsee querend,
zum |
|
|
| |
|
Kattegat über, wo er in
der Nacht zu Montag eintraf. Zugleich schwenkte der zugehörige Trog
nebst |
|
|
|
| |
|
aufkommender
Schauertätigkeit von Nordwesten nach Mitteleuropa. Mit der nordwestlichen
Höhenströmung |
|
|
| |
|
stellte sich an der
Alpennordseite eine Staulage ein, in der die anfängliche Konvektion am
Sonntag tagsüber in |
|
|
| |
|
schauerartig durchsetzten
Dauerregen überging. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am Montag verlagerte
sich das einstige Orkantief unter Abschwächung an die polnische Ostseeküste.
In seinem |
|
| |
|
Rücken gelangten
weiterhin feuchte und kühle Luftmassen in den Alpenraum, sodass hier die
Niederschläge in |
|
|
| |
|
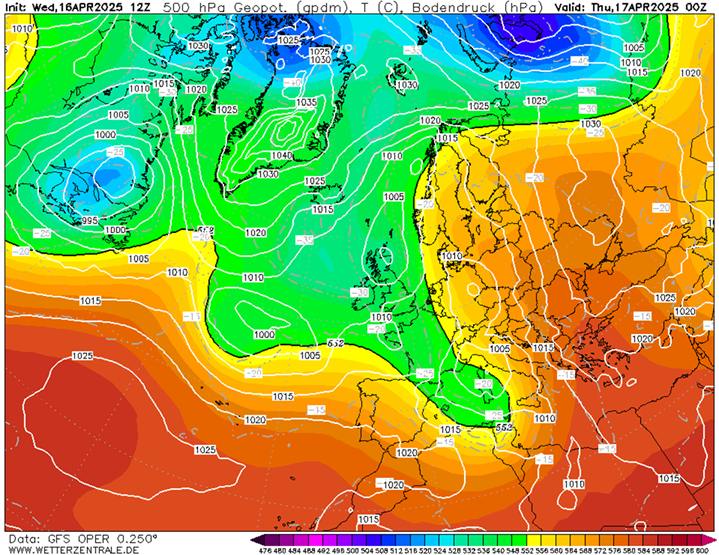
| unterschiedlicher
Intensität andauerten. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Bild: Großwetterlage in
Europa zu Montagmittag |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bis Dienstag wanderte
„Detlef“ ostwärts zum Baltikum ab. Sein Ablegertief über dem östlichen
Mittelmeerraum |
|
|
| |
|
sollte für uns
bedeutungslos bleiben, jedoch Südosteuropa kräftige Niederschläge bringen. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Eine Wetterbesserung fand
aber trotz Trogabzug vorerst nicht statt, denn abseits des zyklonalen
Geschehens |
|
|
| |
|
etablierte sich
zusätzlich von Südwesteuropa her ein Hochdruckgebiet, das durch die Warmluftadvektion eines |
|
|
| |
|
neuen Ex-Hurrikans namens
„Imelda“ gestützt wurde. Am Montag bildete sich das neue Hochzentrum „Rita“
über |
|
|
| |
|
den Westalpen heraus und
sorgte an seiner Vorderseite für die Fortsetzung der nordwestlichen
Strömung. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In diese wurden nun
etwas höher temperierte Luftmassen eingebunden, die als Warmfront des angesprochenen |
|
| |
|
ehemaligen Tropensturms
„Imelda“, nun bei Island kreiselnd, herbeigelenkt wurden. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Zwar stieg durch das nahe
Hoch auch der Luftdruck im Alpenraum, am Wetter merkte man das nicht.
Bis |
|
|
| |
|
Dienstagabend hielt der
Niederschlag an, schwächte sich allerdings schon am Montagabend ab. Der
Charakter |
|
|
| |
|
des Regens hatte sich
von schauerartig durchsetzt in leichten bis mäßigen Dauerregen sowie Später
in teilweise |
|
| |
|
kräftiges Nieseln
gewandelt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Erster Bergschnee und
sechstnassester Oktobertag |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Richtiges Herbstwetter
war mit der Kaltfront und teils steif auffrischendem Nordwestwind am
Samstagabend in |
|
|
| |
|
Hintersee aufgekommen.
Nach einer postfrontalen Beruhigung über Nacht und am Sonntagmorgen kamen
am |
|
|
| |
|
Vormittag wieder erste
Regenschauer ins Tal. Diese verstärkten sich ab den Mittagsstunden und gingen
bis zum |
|
| |
|
Abend in schauerartig
durchsetzten Dauerregen über. Dieser zog sich durch die Nacht auf Montag und
auch am |
|
|
| |
|
Montagvormittag regnete
es mitunter kräftig weiter. Nach einem Abschwellen der Intensität legte der
Regen mit |
|
|
| |
|
Aufzug der Warmfront am
Montagnachmittag nochmals ein Maximum hin, um ab der Nacht zu Dienstag in
den |
|
|
| |
|
gemütlichen Ausklangmodus
überzugehen, welcher bis Dienstagabend anhielt. Während dieser Phase
nieselte |
|
|
| |
|
es durchgehend mäßig bis
stark. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Auf den Bergen stellte
sich von Sonntag auf Montag der erste Schnee der Wintersaison ein. Lag
die |
|
|
|
| |
|
Schneefallgrenze in der
Osterhorngruppe zuerst um 1400 m, sank sie durch die
Niederschlagsintensität |
|
|
| |
|
Montagfrüh bis gegen 1000
m ab. An der nächstgelegenen Bergstation am Zwölferhorn bei St. Gilgen (1.522
m) |
|
|
| |
|
ging die Temperatur auf
-0,5 °C zurück. Auf der Postalm (1.170 m) betrug das Minimum 0,6 °C. An
unserer |
|
|
| |
|
Station in Hintersee
erreichten wir den thermischen Talboden mit 3,2 °C. Ab Montagnachmittag stieg
die |
|
|
| |
|
Schneefallgrenze dann
allmählich wieder gegen Kammniveau an. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Damit kam am Dienstag
auch bereits Schmelzwasser des Bergschnees in die heimischen Fließgewässer,
die am |
|
| |
|
Montag schon durch den
Niederschlag zu einem kleineren Hochwasser angeschwollen waren. Der
Wasserstand |
|
| |
|
des Hintersees kletterte
markant. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Über das Ereignis
betrachtet akkumulierten sich von Samstag- bis Dienstagabend 124,5 l/m².
Davon entfielen |
|
|
| |
|
allein auf den Montag 67
l/m². Im Allgemeinen ist das für Hintersee höchstens eine markante |
|
|
|
| |
|
Niederschlagsmenge, im
Oktober stellte dies jedoch die sechstgrößte Regensumme unserer Messreihe
dar. |
|
|
| |
|
Zuletzt mehr regnete es
an einem Oktobertag mit 114 l/m² am 24. Oktober 2018. Das war zugleich der
bislang |
|
|
| |
|
regenreichste Oktobertag
der Messreihe. Das Ausnieseln sorgte am Dienstag nochmals für 27,5 l/m².
Zuvor |
|
|
| |
|
waren am Sonntag 30 l/m²
gefallen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die größten
Tagesregenmengen im Oktober |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
24.10.2018 |
114,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
21.10.1996 |
113,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
23.10.2014 |
112,5 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4 |
01.10.1997 |
87,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5 |
22.10.2014 |
76,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6 |
06.10.2025 |
67,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7 |
07.10.2011 |
59,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
8 |
09.10.2003 |
54,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9 |
12.10.2009 |
52,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
05.10.2019 |
52,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Kurzer Wintergruß im
Lammertal |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Entgegen den üblichen
Gewohnheiten im Norden Salzburgs sank die Schneefallgrenze nicht wie sonst an
der |
|
|
| |
|
Osterhorngruppe am
tiefsten, sondern es wurde das obere Lammertal Montagvormittag zu einer
kleinen |
|
|
| |
|
frühwinterlichen Enklave.
In Annaberg-Lungötz schneite es bei 0,5 °C bis ins Tal und ab ca. 850 m wurde
es |
|
|
| |
|
weiß. Frisch war es auch
in Rußbach (2 °C) und in St. Koloman (1,9 °C). Etwas milder blieb es in
Abtenau (3,9 |
|
|
| |
|
°C). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Kombination mit der
Niederschlagsintensität konnte die Kaltluft ihre Wirkung unterschiedlich
entfalten. Im |
|
|
| |
|
benachbarten
Salzkammergut zeigte der Feuerkogel (1.618 m) einen Tiefstwert von -0,7 °C.
In Bad Ischl ging die |
|
| |
|
Temperatur auf 5 °C und
in St. Wolfgang (alle Oberösterreich) auf 4,9 °C zurück. Im nördlichen
Flachgau blieb |
|
|
| |
|
es mit 2,2 °C in 1.114 m
am Kolomansberg und 6,9 °C in Mattsee ein Stück milder. Innergebirg war es in
der |
|
|
| |
|
Höhe etwas frischer,
jedoch vermochte die geringere Regenstärke die Kaltluft nicht so gut
hinunterzumischen, |
|
|
| |
|
wie dies im Norden
gelang. So hatte Lofer ein Minimum von 3,9 °C als es auf der Loferer Alm
(1.623 m) auf -1,6 |
|
|
| |
|
°C hinabging. Die Minima
in Zell am See und auf der Schmittenhöhe (1.973 m) betrugen 4,5 bzw. -36,2
°C. |
|
|
| |
|
Richtig kalt war es am
Sonnblick mit -9,2 °C (3.105 m). Auf halber Höhe in Kolm-Saigurn (1.618 m)
ging es auf – |
|
|
| |
|
0,3 °C hinunter und im
Talboden von Rauris auf 4 °C. Auf der Rudolfshütte (2.304 m) waren es -4,5
°C. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Nordstau beim
Niederschlag voran |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Wenig überraschend waren
die Staulagen an der Alpennordseite bei dieser klassischen Nordwestlage
voran. |
|
|
| |
|
Unter diesen
kristallisierte sich nochmals ein Schwerpunkt vom Tiroler Unterland bis zum
Salzkammergut |
|
|
| |
|
heraus. Von den
offiziellen Stationen lag Kössen (Tirol) mit 50,8 l/m² am Montag eindeutig in
Front. Dahinter |
|
|
| |
|
folgten die Rudolfshütte
(37,2 l/m²) und der Feuerkogel (35,5 l/m²). Weiter ging es mit Bad Aussee
(33,7 l/m², |
|
|
| |
|
Steiermark), Mondsee
(33,6 l/m², Oberösterreich) und Bad Ischl (33,5 l/m²). Das dritte Trio
bildeten Kirchdorf |
|
|
| |
|
(32,6 l/m², Tirol), Lofer
(30,7 l/m²) und Abtenau (30,1 l/m²). |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bei den Messstellen des
Hydrografischen Dienstes Salzburg siegte Faistenau mit 49,1 l/m² vor St.
Koloman mit |
|
|
| |
|
43,4 l/m² und der
Postalm mit 37,2 l/m²). Anschließend reihten sich Rußbach (36,1 l/m²),
Filzmoos (34,4 l/m²) und |
|
| |
|
Fuschl (32,3 l/m²) ein. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle:
www.wetterzentrale.de, wetter.orf,at, www.austrowetter.at, salzburg.gv.at,
www.12erhorn.at Private |
|
|
| |
|
Wetterstation
Annaberg-Lungötz von Stefan Pirnbacher |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Tagesrangliste Regen |
>> Tagestemperaturen |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mi,
01.10.25 |
Rückblick
September: Gemütlicher Herbstauftakt mit spätem Sommergruß |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 171,5 l/m² Regen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 12,8 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 2 Sommertage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 4 Gewitter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der September ist nun der
erste Monat unserer Stationsgeschichte, der ein drittes Jahrzehnt in der
Messreihe |
|
|
| |
|
vollendet. 6.625 l/m²
Regen und immerhin 4,5 cm Schnee sind seit 1996 gefallen. Der Beitrag des
Septembers |
|
|
| |
|
2025 lag beim
Niederschlag ein knappes Viertel unter dem Soll. Das Temperaturmittel kam im
üblichen |
|
|
| |
|
Schwankungsbereich über
dem Normal ins Ziel. Die Witterung im Auftakt des meteorologischen
Herbstes |
|
|
| |
|
pendelte zwischen wenig
ergiebigen Fronten und kurzen Hochdruckphasen. Die Nächte blieben mild, bei
Sonne |
|
|
| |
|
wurde es warm. Vor allem
am 20. Und 21. September gab es nochmals relativ späte Sommertage. Dafür |
|
|
| |
|
gewitterte und schauerte
es in der Nacht von 15. Auf 16. September ordentlich. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Beginn des
meteorologischen Herbstes stand unter ostwärts durchziehenden
Zwischenhocheinfluss. Bald |
|
|
| |
|
darauf kamen wir in die
Störungszone eines Tiefs bei den Britischen Inseln, das ein Ablegertief über
Oberitalien |
|
|
| |
|
mit sich führte. Ein
Nordmeertief brachte zur Mitte der ersten Dekade frische Luft in den
Alpenraum, wo diese |
|
|
| |
|
von Westen her unter
Hochdruck geriet. Das Zepter wurde sogleich von einem blockierenden Hoch
über |
|
|
| |
|
Nordwestrussland
übernommen. Dieses musste die Vorherrschaft aber zeitnah an ein steuerndes
Islandtief |
|
|
| |
|
abgeben, welches mit
einem Randtief bei England wechselhaftes Wetter über den ersten
Dekadenwechsel |
|
|
| |
|
hinaus etablierte. Zur
Monatsmitte querte schlussendlich das System den Kontinent. Zügig folgte
jedoch ein |
|
|
| |
|
neues Sturmtief bei
Schottland, dessen Kaltfront für kräftigen Gewitterregen sorgte. Danach
stellte sich für einige |
|
| |
|
Tage Beruhigung ein und
es wurde spätsommerlich warm. Die Hochdruckbrücke zwischen den Azoren
und |
|
|
| |
|
Nordwestrussland schloss
sich, sodass sich ein separates Hochdruckgebiet, von Skandinavien bis
Italien |
|
|
| |
|
reichend, mit Kern über
dem Balkan herausbilden konnte. Aus der bisher herrschenden warmen West-
bis |
|
|
| |
|
Südwestströmung wurde
eine südliche, mit welcher Subtropikluft zum zweiten Dekadenwechsel advehiert
wurde. |
|
| |
|
Ein folgender Trog mit
einem nach Skandinavien wandernden Tief läutete das letzte Monatsdrittel ein.
Vom Trog |
|
|
| |
|
spaltete sich ein
Höhentief ab, das sich für ein paar Tage über Frankreich einquartierte.
Feuchte und mäßig |
|
|
| |
|
warme Luftmassen
gestalteten das Wetter ab da an mit viel Bewölkung und ein bisschen Regen.
Bis zur Mitte |
|
|
| |
|
des Schlussdrittels baute
sich über Skandinavien ein Hochdruckgebiet auf, das sich bis Monatsende
ostwärts |
|
|
| |
|
nach Fennoskandien
verlagerte. An seiner Südflanke wurde das Höhentief über Frankreich zwar
südwärts |
|
|
| |
|
abgedrängt, jedoch nahm
ein neues Höhentief in der nordöstlichen Strömung von Osten her Kurs auf |
|
|
|
| |
|
Mitteleuropa. Die letzten
Septembertage verliefen unter Einfluss dieses Tiefs leicht östlich von
Österreich |
|
|
| |
|
anhaltend unbeständig und
etwas kühler als zuvor. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der September gestaltete
in Österreich sein Temperaturniveau in den ersten beiden Dekaden |
|
|
|
| |
|
überdurchschnittlich,
danach ging es bergab in Richtung jahreszeitlichen Normalzustand. Bundesweit
gemittelt |
|
|
| |
|
lagen die Temperaturen im
Tiefland um 1,4 °C über dem Klimamittel 1991-2020, was Platz 18 in der |
|
|
|
| |
|
österreichischen
Messgeschichte bedeutete. Auf den Bergen betrug die Abweichung +1,8 °C (Platz
19). Im |
|
|
| |
|
Vergleich zur
Referenzperiode 1961-90 lagen die Abweichungen bei +1,8 °C bzw. +1,7 °C. Nach
ziemlichen |
|
|
| |
|
Ausschlägen in den
vergangenen beiden Jahren pendelte sich der September in Sachen Niederschlag
diesmal |
|
|
| |
|
mit +4 % Abweichung recht
gut am Durchschnitt ein. Regional gab es aber deutliche Unterschiede.
Von |
|
|
| |
|
Vorarlberg bis
Oberösterreich fehlte ein Achtel bis ein Drittel. AM trockensten war es dabei
im Flachgau, Inn- und |
|
| |
|
Hausruckviertel mit
Defiziten bis zur Hälfte des Üblichen. Relativ betrachtet
niederschlagsärmster Ort war |
|
|
| |
|
Mattsee mit einer
Abweichung von -48 % (60 l/m²). In Mattsee verlief bereits der August
historisch trocken. Im |
|
|
| |
|
Tiroler Oberland und vom
Pinzgau bis zur Weststeiermark fiel die Bilanz ausgeglichen aus. Im Süden
ging der |
|
|
| |
|
September aufgrund von
Italientiefs mit Überschüssen bis zur Hälfte vorbei. Einen Fleckerlteppich
hinterließ der |
|
|
| |
|
Niederschlag im
Nordosten. Zwischen einem Drittel zu wenig und der Hälfte zu viel fand sich
hier alles vertreten. |
|
|
| |
|
Lokal regnete es im Wald-
und weinviertel teils sogar das Doppelte des Solls. Nassester Ort war
Mönichkirchen |
|
|
| |
|
(Niederösterreich) mit
205 l/m². Die Sonnenscheinbilanz fügte sich mit -6 % ebenso gut in die
Statistik ein. Die |
|
|
| |
|
Sonne schien meist
österreichweit im erwartbaren Bereich. Einzig ganz im Westen und lokal im
Süden gab es |
|
|
| |
|
Einbußen bis zu einem
Drittel. Sonnigster Platz war Andau (Burgenland) mit 210 Sonnenstunden. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der September beließ es
heuer in Hintersee wieder rein beim flüssigen Niederschlag. Die
Schwankungsbreite, |
|
|
| |
|
die wir seit 2023
erlebten, war dabei schon enorm. Nach dem zweittrockensten September 2023 mit
67 l/m² |
|
|
| |
|
folgte im Vorjahr der
neue Rekord mit 517,5 l/m². Dieses Jahr war der September in der
Ladenbachmetropole mit |
|
| |
|
171,5 l/m² bei einer
Abweichung von -23 % wieder auf der unterdurchschnittlichen Seite, die ihm
einen Platz im |
|
|
| |
|
unteren Mittelfeld
einbrachte. Hinten dran nun die September aus 2015 (145 l/m²) und 2005 (144,5
l/m²). Der |
|
|
| |
|
regen verteilte sich im
heurigen September auf 16 Regentage (+2 Tage). Am meisten regnete es mit 45
l/m² am |
|
|
| |
|
16. September. Dagegen
blieb es vom 17. Bis 22. September 6 Tage hintereinander trocken. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Gewittertätigkeit war
im September erwartungsgemäß in ihrer Quantität überschaubar. Die
einzelnen |
|
|
| |
|
Entwicklungen hatten aber
durchaus Potential. AN 4 Gewittertagen zogen ebenso viele Gewitter über
das |
|
|
| |
|
Gemeindegebiet. Die
heftigste Konvektion werkte am Abend des 15. Septembers. Steife bis
stürmische |
|
|
| |
|
Windböen trieben
wolkenbruchartigen Regen über das Land, der mit den anschließenden
starken |
|
|
|
| |
|
Kaltfrontschauern des
Sturmtiefs „Zac“ bei Schottland bis zum Morgen eine Regensumme von 45
l/m² |
|
|
| |
|
akkumulierte. Gräben und
Bäche führten aufgrund der Niederschläge ein leichtes Hochwasser. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Meist seichter Wellengang
herrschte im September bei den Temperaturen. Diese blieben über den
ganzen |
|
|
| |
|
Monat gesehen ohne große
Ausreißer nach oben oder unten. Jedoch geschah dies auf einem
durchgehend |
|
|
| |
|
leicht (erste Dekade) bis
markant zu warmen (zweite und dritte Dekade) Niveau. So betrug das
Monatsmittel mit |
|
|
| |
|
12,8 °C bei einer
Abweichung von +1,4 °C. Gemeinsam mit 2009 war es der achtwärmste September
unserer |
|
|
| |
|
Messreihe, wodurch er
sich im oberen Mittelfeld einreihte. Den Tiefstwert gab es mit 6,6 °C am 6.
Und 30. |
|
|
| |
|
September. AM wärmsten
wurde es mit 25,1 °C am 20. September und mit 25,2 °C am 21. September. Die
Zahl |
|
| |
|
der Sommertage lag mit 2
Tagen genau im langjährigen Schnitt. Diese ereigneten sich zumeist früher in
einem |
|
|
| |
|
September. So späte
Sommertage wie heuer gab es in unserer Messreihe in gebündelter Form zuletzt
am 23. |
|
|
| |
|
Und 24. September 2006
sowie vom 19. Bis 22. September 2003. Einzelereignisse zeugen noch von
einem |
|
|
| |
|
ähnlich späten Sommertag
am 21. September in den Jahren 2018 und 2023. Kalte Tage gab es diesmal 1 Tag
(- |
|
| |
|
3 Tage). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Tagestemperaturen |
>> Gewitterstatistik |
|
| |
|
|
>> Tagesrangliste Regen |
>> Monatsvergleich Temp. |
|
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Klimatage |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Di,
16.09.25 |
Gewitter
auf Zack mit Wassersack |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die heuer bisher dürftige
Gewittertätigkeit lieferte gestern Abend und damit schon sehr spät in der
Saison ihren |
|
|
| |
|
voraussichtlichen
Höhepunkt. Es windete und schüttete unerwartet kräftig. Die 45 Liter
Niederschlag ließen |
|
|
| |
|
Gräben und Bäche zu einem
kleineren Hochwasser anschwellen und rissen Furchen in Schotterwege. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Zack bringt Gewitter und
Kaltfront |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Wetterlage am Montag
zeigte das verantwortliche Sturmtief mit dem originellen Namen „Zack“ über
der |
|
|
| |
|
nördlichen Nordsee
liegend. An seiner Vorderseite wurde mit einer südwestlichen Strömung
warm-feuchte |
|
|
| |
|
Subtropikluft in den
Alpenraum geführt. Das Gastspiel war jedoch von kurzer Dauer, denn die
Kaltfront von |
|
|
| |
|
„Zack“ steuerte bereits
am Montag aus Nordwesten über Mitteleuropa hinweg auf den Alpenraum zu. Im
Vorfeld |
|
|
| |
|
der Front bildeten sich
am Montagabend über der Schweiz, dem westlichen Österreich und südlichen |
|
|
| |
|
Deutschland Gewitter aus,
die im weiteren Verlauf ostwärts zogen. Hinter den Gewittern schloss sich
gleich die |
|
|
| |
|
Kaltfront an, die die
Niederschläge über die Nacht fortsetzte. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Starkgewitter mit
Wolkenbruch in Hintersee |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Gegen halb zehn Uhr
abends kündigte das Gewitter mit Wetterleuchten aus Richtung Westen seine
baldige |
|
|
| |
|
Ankunft über dem
Gemeindegebiet an. Etwas später folgten erste Donner, ehe es kurz vor 22 Uhr
ernst wurde. |
|
|
| |
|
Wind kam auf und
Starkregen setzte ein. Nun wetterte es mit wolkenbruchartigen Regen, der von
steifen bis |
|
|
| |
|
stürmischen Wind über das
Land getrieben wurde. Einzelne Zweige knickten von Bäumen, auf den Straßen
rann |
|
|
| |
|
das Wasser wie in einem
Bachlauf. Schotterwege wurden ausgespült. Nach Abzug des Gewitters brachte
die |
|
|
| |
|
folgende Kaltfront über
die Nacht weitere kräftige Regenschauer. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
45 Liter in Hintersee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bis zum morgen waren an
unserer Station in Hintersee 45 l/m² gefallen. Das Meiste davon ergoss sich
während |
|
|
| |
|
des Gewitters auf das
Gemeindegebiet. Hier und auch in Faistenau, wo 29,9 l/m² fielen, tobte dem Anschein |
|
|
| |
|
nach das Gewitter am
heftigsten. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Auf der Postalm brachte
das Gewitter 29,7 l/m² und in Abtenau 26,2 l/m². In Bad Ischl regnete es 27,6
l/m² und |
|
|
| |
|
am Feuerkogel (beide
Oberösterreich) 36,5 l/m², welche die größte Menge einer offiziellen Station
in Österreich |
|
|
| |
|
war. Etwas weniger gab es
in Golling (25,2 l/m²), Rußbach (23,1 l/m²), Elsbethen (23 l/m²) und St.
Koloman (22,6 |
|
|
| |
|
l/m²). Abgeschwächter zog
die Gewitterlinie nördlich von uns durch und hinterließ in Fuschl 19,9 l/m²,
in |
|
|
| |
|
Salzburg/Freisaal 17,9
l/m² und in Thalgau 15,7 l/m². |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: wetter.orf.at,
salzburg.gv.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Tagesrangliste Regen |
>> Gewitterstatistik |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Fr,
05.09.25 |
Vorschau:
Wetterfrosch als Radiomoderator |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
en als
Hobby-Radiomoderator unterwegs. Um 8 Uhr |
|
|
|
|
|
|
| |
|
im Freien Radio
Salzkammergut und um 16 Uhr im Museumsradio 1476 darf ich als Gastsprecher in
der |
|
|
| |
|
Sendung „Ums Eck umi
gschaut“ von Radiomacher Werner Miklautsch eindrucksvolle Erinnerungen an
das |
|
|
| |
|
Almleben in früheren
Zeiten präsentieren. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit musikalischer
Umrahmung aus Hintersee vom Feichtensteiner Echo und dem Duo Gundi und Maridi
geht es |
|
|
| |
|
auf die Moosangerlalm in
St. Koloman. Dort war Katharina Loach zehn Sommer lang von 1938 bis 1947 |
|
|
| |
|
Sennerin. Fünf Jahrzehnte
später erzählte sie mir von ihren Erlebnissen aus dieser beschwerlichen und
zugleich |
|
|
| |
|
doch auch unbekümmerten
Zeit. Aus diesen Tonbandaufnahmen ist erst eine kleine Geschichtenreihe für
den |
|
|
| |
|
Privatgebrauch
Entstanden, ehe sich Werner Miklautsch der Sache freudigst annahm und die
Anekdoten der |
|
|
| |
|
Katharina samt mir als
Gastmoderator in seine volksmusikalische Sendung holte. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
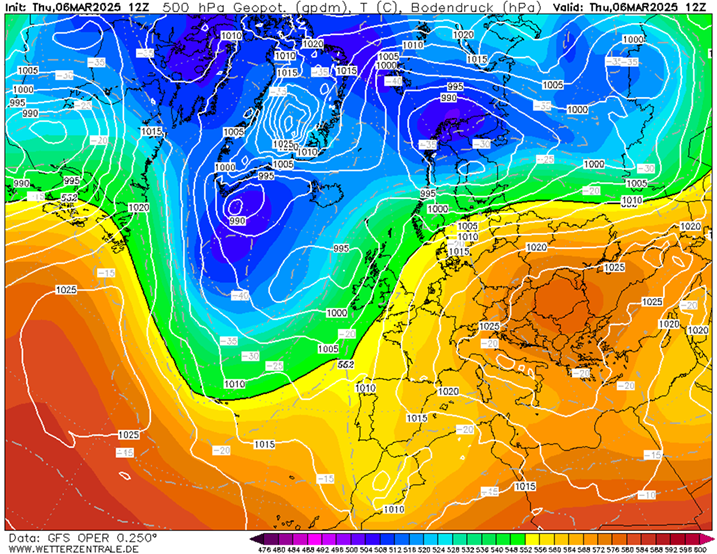
| Vor 2
Jahren durfte ich selber bei „Ums Eck umi gschaut“ das erste Mal zu Gast
sein und die Wetterstation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Hintersee in einem
ausführlichen Interview vorstellen. Letztes Weihnachten war ich außerdem in
zwei weiteren |
|
|
| |
|
Sendungen an den
Weihnachtsfeiertagen als Autor mit Gedichten vertreten. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Sendungsinfo |
>> Radiomacher.at |
>> Freies Radio Salzkammergut |
|
| |
|
|
>> Museumsradio 1476 |
>> Nachhören |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mo,
01.09.25 |
Rückblick
August: Hochsommer kehrt zurück, danach Normalkostglück |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 176,5 l/m² Regen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 15,9 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 10 trockene Tage am
Stück |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 1 Gewitter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Im August endete nicht
nur der meteorologische Sommer, sondern auch die genau einen Monat
andauernde |
|
|
| |
|
regenanfällige Witterung,
indem die Sonne Überstunden abbauen durfte. Hochsommerlich und trocken ging
es |
|
|
| |
|
im Anschluss weiter,
wodurch es für einen August lange 10 Tage hintereinander ohne Niederschlag
blieb. Der |
|
|
| |
|
August war der trockenste
seit 7 Jahren. Die zweite Augusthälfte verlief unauffällig. Wie ein scheues
Reh mit |
|
|
| |
|
neuer Negativleistung
versteckte sich die elektrische Konvektion. In Sachen Temperatur schlossen
der |
|
|
| |
|
achtwärmste August und
der siebtwärmste Sommer mit dem gleichen Mittel überdurchschnittlich ab.
Der |
|
|
| |
|
Sommer 2025 hatte durch
Juni und August ein Niederschlagsminus. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am Beginn des Augusts
stand der Alpenraum unter nordwestlicher Strömung im Einflussbereich eines
Tiefs bei |
|
|
| |
|
Dänemark.
Hochdruckgebiete fanden sich über Nordost- und Südeuropa. Ein weiteres Tief
bei den Britischen |
|
|
| |
|
Inseln setzte die
schaueranfällige Witterung aus dem Juli noch fort, ehe sich von Westen her
Hochdruck im |
|
|
| |
|
Alpenraum durchsetzen
konnte. Noch während des ersten Augustdrittels zog sich der Tiefdruck auf die
Gebiete |
|
|
| |
|
zwischen dem
Nordostatlantik und Nordskandinavien zurück. Hier fungierte ein zum Baltikum
wanderndes Hoch |
|
|
| |
|
als Brücke zwischen dem
Azorenhoch und Hochdruck über Osteuropa. Mit einem neuen Hochkern, der
beim |
|
|
| |
|
Schwenk in die
Mitteldekade von Westen ins östliche Mitteleuropa zog, drehte die
Höhenströmung auf Südwest |
|
|
| |
|
und es kam subtropische
Warmluft herbei. Diese verweilte bis zur Monatsmitte, ehe sich ein Tief
über |
|
|
| |
|
Skandinavien bemerkbar
machte. Gleich darauf drängte von einem Hoch über den Britischen Inseln
erneut ein |
|
|
| |
|
Keil in den Alpenraum.
Die Strömung drehte an dessen Vorderseite allerdings auf Nordwest. Beim
Wechsel in |
|
|
| |
|
das letzte Augustdrittel
wurde der Hochdruck ostwärts abgedrängt und ein nach Skandinavien ziehendes
Tief |
|
|
| |
|
etablierte ein
Ablegertief über Italien. Mit feuchter und labiler Luft aus dem
Mittelmeerraum kam es zu einem |
|
|
| |
|
markanten Regenereignis.
Nach Abzug des Troges stellte sich an der Vorderseite eines breiten |
|
|
|
| |
|
Hochdruckgebietes, das
von der Iberischen Halbinsel bis Grönland reichte, eine trockene, aber
kühle |
|
|
| |
|
Nordströmung ein. Für
einige Tage dominierte der antizyklonale Einfluss von Westen her. Zur Mitte
der letzten |
|
|
| |
|
Augustwoche wechselte die
Strömung wieder auf Südwest zurück. Bei den Britischen Inseln hatte sich
ein |
|
|
| |
|
Sturmtief eingefunden.
Inklusive Ablegertief bei Italien sorgten die Druckminima für einen warmen
und |
|
|
| |
|
wechselhaften Ausklang
des Augusts, der ganz zum Schluss nochmals mit Zwischenhocheinfluss ein
sonniges |
|
|
| |
|
Ende nahm. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Durch den wiederholten
Hochdruck war der August mit -26 % an Niederschlag einer der 30 trockensten
der |
|
|
| |
|
heimischen
Messgeschichte. Ähnlich regenarm verliefen bereits seine Vorgänger aus 2024
(-28 %) und 2019 (- |
|
|
| |
|
25 %). Die Verteilung
war, wie für einen Sommermonat typisch, aufgrund Schauern und Gewittern sehr
variabel. |
|
|
| |
|
Beinahe staubtrocken ging
es mit Einbußen bis zu drei Viertel in Unterkärnten und der Weststeiermark
her. In |
|
|
| |
|
einem breiten Bogen von
Salzburg bis in den Südosten Österreichs fehlten zwischen einem Viertel und
der |
|
|
| |
|
Hälfte. Wobei es lokal
im Nordburgenland in Folge stationären Starkregens am 21. August ein Plus bis
zu 131 % |
|
| |
|
(Neusiedl am See) gab.
Hier schüttete es binnen ein paar Stunden 89 l/m². Im Westen bis Osttirol
einerseits und |
|
|
| |
|
der Obersteiermark
andererseits bilanzierte der August im Großen und Ganzen um den langjährigen
Schnitt. |
|
|
| |
|
Nassester Ort war
Laterns (Vorarlberg) mit 331 l/m². Den trockensten August erlebte dagegen
Mattsee mit nur 61 |
|
| |
|
l/m² (Messung seit 1949).
Mit +8 % etwas häufiger als im Soll schien die Sonne. Im Westen und Süden war
die |
|
|
| |
|
Sonnenscheinbilanz
ausgeglichen. Ansonsten lag sie bis zu einem Viertel über dem Normal.
Sonnenreichster |
|
|
| |
|
Ort war Hohenau an der
March (Niederösterreich) mit 311 Stunden. Bei den Temperaturen resultierte
im |
|
|
| |
|
Vergleich zum aktuellen
Klimamittel 1991-2020 in den Niederungen ein leichtes Plus von 0,5 °C. Auf
den Bergen |
|
| |
|
betrug die Abweichung
+0,8 °C. Damit reihte sich der heurige August auf den Rängen 20 bzw. 18 in
der |
|
|
| |
|
österreichischen
Messhistorie ein. Verglichen mit der Normalperiode 1961-90 war der
diesjährige August um 2,4 |
|
| |
|
bzw. 2,6 °C zu warm. Mit
einem Kaltluftvorstoß sanken ab dem 23. August für einige Tage die
Tiefstwerte im |
|
|
| |
|
Mühl- und Waldviertel
stellenweise auf wenige Plusgrade. In Kirchschlag bei Linz (Oberösterreich)
gab es |
|
|
| |
|
beispielsweise mit 4,2 °C
die tiefste Augusttemperatur seit Messbeginn 1999. In exponierten
Dolinenlagen kam |
|
|
| |
|
es sogar zum ersten
leichten Frost. Die Mangelnde Gewittertätigkeit sorgte diesen Monat für das
Kuriosum, dass |
|
| |
|
in Wien nur eine einzige
Blitzentladung detektiert wurde. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Hintersee war der
heurige August mit einer Regensumme von 176,5 l/m² bei einem Minus von 27 %
der |
|
|
| |
|
trockenste August seit
2018 (128,5 l/m²). Damit kam er über einen Platz im unteren Drittel nicht
hinaus. Am |
|
|
| |
|
meisten regnete es mit
40 l/m² am 21. August. Es gab gesamt 15 Regentage (-2 Tage). Auch diese Zahl
war die |
|
| |
|
geringste seit 7
Jahren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dafür blieb es vom 7. Bis
16. August 10 Tage hintereinander niederschlagsfrei. In unserer Messreihe war
dies |
|
|
| |
|
die längste Periode ohne
Niederschlag, die zur Gänze oder überwiegend in einem August lag. Bisher
blieb es |
|
|
| |
|
maximal 9 Tage am Stück
regenfrei (20. Bis 28. August 2003 und 3. Bis 11. August 2004). Wie selten so
eine |
|
|
| |
|
lange Trockenphase ist,
zeigen uns die Daten der Hydrografischen Station in Faistenau. Ebenso 10
Tage |
|
|
| |
|
durchgehend trocken
blieb es in den Augustmonaten 1961 und 1995. 11 Tage an Stück
niederschlagsfrei war es |
|
| |
|
zudem 1923 und 1959. Die
absolut längste Periode ging über 13 Tage und ereignete sich vom 11. Bis zum
23. |
|
|
| |
|
August 1898. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Einen Negativrekord gab
es bei der Gewittertätigkeit. Für einen Sommermonat äußerst untypisch zog
diesen |
|
|
| |
|
August nur ein einziges
Gewitter über das Gemeindegebiet. Am 17. August nachts gab es starken Regen
und |
|
|
| |
|
einen Naheinschlag.
Bislang waren die Augustmonate aus 2014 und 2015 mit 3 Zellen die
gewitterärmsten. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die erwähnte Periode ohne
Regen war zugleich die wärmste Phase des Monats. 10 der 11 Sommertage
(+1 |
|
|
| |
|
Tage) ereigneten sich in
dieser Zeit Selbstredend fiel auch der durchschnittlich 1 heiße Tag in jenen
Abschnitt. |
|
|
| |
|
Das Monatsmaximum wurde
mit 30,2 °C am 13. August verzeichnet. Am tiefsten sank das Thermometer mit
8,5 |
|
|
| |
|
°C am 24. Und 25. August.
Die Monatsmitteltemperatur betrug 15,9 °C und lag mit 0,6 °C etwas über
dem |
|
|
| |
|
langjährigen Schnitt. Der
August 2025 reihte sich damit ex aequo mit dem August 2023 auf dem 8. Platz
ein. Im |
|
|
| |
|
Vorjahr stellten wir noch
den absoluten Stationsrekord aus dem August 2003 ein. Heuer verlief besonders
die |
|
|
| |
|
zweite Augustdekade
deutlich zu warm. Die Drittel eins und drei fielen ganz leicht zu kühl aus. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit dem August endete
zugleich der meteorologische Sommer, der die gesamten Monate Juni, Juli und
August |
|
|
| |
|
umfasst. Das Wetter
präsentierte sich dabei in Österreich im Juni und in der ersten Juliwoche
sehr warm bis |
|
|
| |
|
heiß. Vor allem die Zeit
um den Monatswechsel Juni auf Juli verlief hochsommerlich temperiert. Der
Südosten |
|
|
| |
|
des Landes stach mit
extrem hohen Temperaturen hervor. AM 26. Juni wurde mit 38,3 °C in Feistritz
(Kärnten) |
|
|
| |
|
der höchste Wert des
Sommers gemessen. Anschließend ging es im Juli bergab und eine
verhältnismäßig kühle |
|
| |
|
und regnerische Witterung
folgte bis Anfang August. Zwar entsprachen die Temperaturen in dieser
Phase |
|
|
| |
|
durchaus dem langjährigen
Mittel, in Folge der zahlreichen heißen und sonnigen Sommer der letzten
Jahre |
|
|
| |
|
verführte dies wohl zur
irrtümlichen Empfindung ungewohnter Kälte. Der August war, wie schon
ausführlich |
|
|
| |
|
besprochen, wieder
trocken und sommerlich warm. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Gemittelt über alle drei
Monate ergab sich für Österreich der achtwärmste Sommer der Messgeschichte.
Im |
|
|
| |
|
Vergleich zur aktuellen
Klimareferenzperiode war er im Tal um 1,1 °C und auf den Bergen um 1,4 °C zu
warm. |
|
|
| |
|
Nach dem Rekordsommer
2024 reihte sich auch der Sommer nahtlos in den Erwärmungstrend der letzten
gut 3 |
|
|
| |
|
Jahrzehnte ein. Die 10
wärmsten Sommer stammten aus den Jahren 2024, 2003, 2019, 2015, 2022, 2017,
2018, |
|
| |
|
2025, 2023 und 1992.
Verglichen mit der vorherigen Normalperiode 1961-90 war der heurige Sommer um
2,9 °C |
|
| |
|
bzw. 3,1 °C zu warm. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Niederschlagsbilanz
fiel aufgrund des nassen Julis mit -7 % nicht so übel aus, wie Das Juni und
August |
|
|
| |
|
vermuten ließen. Recht
trocken war es dabei im heißen Süden. In Unterkärnten und der Weststeiermark
fehlten |
|
|
| |
|
ein Viertel bis die
Hälfte des Niederschlags. Nassester Platz war die Rudolfshütte mit 948 l/m². |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Sonnenscheindauer
erfuhr nach einem sehr sonnigen Juni im Juli einen satten Dämpfer. Am Ende
stand ein |
|
|
| |
|
Plus von 8 %. Sonnigster
Ort war Neusiedl am See (Burgenland) mit 874 Sonnenstunden. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Im Bundesland Salzburg
schien die Sonne gemittelt um 7 % länger als im Schnitt. Sonnigster Platz war
der |
|
|
| |
|
Flughafen mit 715
Sonnenstunden. Die Niederschlagsabweichung betrug -4 %. Der nasseste Ort fand
mit der |
|
|
| |
|
Rudolfshütte bereits
Erwähnung. Die höchste Temperatur wurde diesen Sommer am 2. Juli mit 34,2 °C
in |
|
|
| |
|
Bischofshofen gemessen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Hintersee verging der
Sommer 2025 mit der für ganz Österreich schon beschriebenen
Wettercharakteristik. |
|
|
| |
|
Die Mitteltemperatur lag
diesen Sommer bei 15,9 °C. Mit einer Abweichung von +0,7 °C war der heurige
Sommer |
|
| |
|
gleich warm wie jener aus
2023. Beide Sommer rangieren nun auf dem 7. Platz. Zum Vorsommer fehlten
uns |
|
|
| |
|
weitere 0,7 °C. Die Zahl
der Sommertage betrug mit 37 um 9 mehr als im Durchschnitt und lag gleichauf
wie |
|
|
| |
|
2024. An Hitzetagen
zählten wir leicht überdurchschnittlich 6 Tage (+1 Tag). Es gab keinen kalten
Tag (-2 Tage). |
|
|
| |
|
Jeweils die Hälfte der
Sommer- und Hitzetage ereignete sich im Juni. Die höchste Temperatur zeigte
das |
|
|
| |
|
Thermometer mit 31,9 °C
am 2. Juli. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die sommerliche
Niederschlagssumme bilanzierte mit 656,5 l/m² um 8 % unter dem Mittel,
wodurch sich der |
|
|
| |
|
diesjährige Sommer im
unteren Drittel unserer Messreihe einsortierte. Mengenmäßig pendelte er sich
gut |
|
|
| |
|
zwischen den beiden
Vorsommern 2023 (696 l/m²) und 2024 (614 l/m²) ein. Es gab insgesamt 52
Regentage (-2 |
|
| |
|
Tage). Knapp die Hälfte
davon entfielen auf den Juli. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at,
www.facebook.com (Seite wetter-muehlviertel.at) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Sommervergleich Regen |
>> Sommervergleich Temp. |
|
| |
|
|
>> Monatsrangliste Niederschl. |
>> Tagestemperaturen |
>> Klimatage |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Monatsvergleich Temp. |
>> Gewitterstatistik |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Fr,
01.08.25 |
Rückblick
Juli: Nach Hitzestart ins kühle Bad |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 344 l/m² Niederschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 24 Regentage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 15,2 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 31,9 °C Tageshöchstwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dem Juli dürfte das
sonnig-heiße Wetter aus dem Vormonat wohl zu viel geworden sein. Nach einer
Woche |
|
|
| |
|
Hochsommer verdrückte er
sich in den Schatten und drehte die Brause auf, um sich Kühlung zu
verschaffen. Die |
|
|
| |
|
nächsten Wochen brachten
eine regenanfällige Witterung auf moderatem Temperaturniveau. Ein Umstand,
der |
|
|
| |
|
aufgrund des
Sonnenmangels grimmiger empfunden werden konnte als Regen- und
Temperaturbilanz dies über |
|
|
| |
|
den Gesamtmonat hergaben.
Mit 39 % mehr an Niederschlag war es der fünftnasseste Juli in der
Hinterseer |
|
|
| |
|
Hinterseer Messreihe. Die
Mitteltemperatur lag leicht unter Schnitt, wobei es letztmals vor 13 Jahren
kühler war. |
|
|
| |
|
Die Zahl der Regentage
war die dritthöchste, jene an Gewittern blieb klein. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Julistart stand im
Zeichen von Hochdruck über dem östlichen Mitteleuropa. An der Vorderseite
eines |
|
|
| |
|
Islandtiefs wurde
subtropische Warmluft in den Alpenraum advehiert. Ein erster Frontvorstoß
wurde sogleich von |
|
|
| |
|
einem nachrückenden Keil
des Azorenhochs zugekleistert. Ein weiteres nach Nordosteuropa ziehendes |
|
|
| |
|
Islandtief läutete zur
Mitte der ersten Dekade eine wechselhafte Witterung mit wiederholten
Regenschauern und |
|
|
| |
|
Abkühlung ein. Zudem zog
zum Dekadenwechsel ein Ablegertief von Italien nach Polen, an dessen
Rückseite |
|
|
| |
|
ein kühler Nordwestwind
wehte. Der Hochdruck blieb dagegen über dem Ostatlantik Stecken und breitete
sich |
|
|
| |
|
zur Monatsmitte über
Nordeuropa mit Zentren über der Nordsee und Westrussland aus. So musste
das |
|
|
| |
|
Ablegertief über dem
nördlichen Mitteleuropa westwärts wandern, wodurch sich hierzulande eine
mäßig warme |
|
|
| |
|
Westströmung einstellte.
Durch einen Tiefvorstoß auf dem Nordostatlantik wurde das langlebige
Ablegertief |
|
|
| |
|
durch dessen Trog
eingefangen und nach der Julimitte ins östliche Mitteleuropa zurückgeschoben.
Zum |
|
|
| |
|
Schwenk in die dritte
Monatsdekade baute sich von Südwesten her Hochdruck auf, der die Brücke
zum |
|
|
| |
|
Druckmaxima über
Nordeuropa schloss. Im Vorfeld der nächsten atlantischen Störung wurde es
kurz sommerlich |
|
| |
|
warm. Das von den
Britischen Inseln südostwärts wandernde Tief stellte den Hebel aber sehr bald
wieder auf |
|
|
| |
|
wechselhaft retour. Ein
Ablegertief, das vom Mittelmeerraum nordostwärts zog, eröffnete eine kühle
und nasse |
|
|
| |
|
letzte Juliwoche. Durch
ein Zusammenspiel aus feuchter Mittelmeerluft und maritimer Atlantikluft kam
es erneut |
|
|
| |
|
zu zahlreichen
Regenschauern und Abkühlung. Eine Kaltfront brachte zudem ein markantes
Regenereignis an |
|
|
| |
|
der Alpennordseite. Mit
einer Nordwestströmung blieb es im letzten Julidrittel relativ frisch für die
Jahreszeit. Ein |
|
|
| |
|
Tief bei Dänemark sorgte
im Anschluss für einen unbeständigen Ausklang des Julis. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Nach der ersten heißen
Woche sorgten die zahlreichen Fronten in Österreich oftmals für einen
bewölkten |
|
|
| |
|
Himmel. Diese machten den
heurigen Juli mit -27 % Abweichung bei der Sonnenscheindauer zum |
|
|
|
| |
|
sonnenärmsten Juli seit
1979. Generell war es einer der 15 unsonnigsten Julimonate in der
heimischen |
|
|
| |
|
Messgeschichte. Ein
kleines Minus bis zu einem Viertel weniger an Sonne bekamen die Regionen
von |
|
|
| |
|
Oberösterreich in einem
Bogen um die Ostalpen herum bis nach Kärnten. Vom Westen bis ins
südliche |
|
|
| |
|
Oberösterreich hinein
zeigte sich die Sonne bis zu einem guten Drittel seltener. Besonders unsonnig
war es in |
|
|
| |
|
den höher gelegenen
Teilen Tirols, Salzburgs und Kärntens mit Einbußen bis zur Hälfte des Solls.
SO |
|
|
| |
|
summierten sich am
Sonnblick lediglich 87 Sonnenstunden bei einer Abweichung von -51 %.
Sonnenreichster |
|
|
| |
|
Ort war Bad Radkersburg
(Steiermark) mit 255 Sonnenstunden. Der Tiefdruckeinfluss brachte neben
Frontregen |
|
| |
|
auch zahlreiche
Regenschauer und teils heftige Gewitter. Dadurch wurde es im Juli
insbesondere nördlich der |
|
|
| |
|
Alpen relativ nass mit
Überschüssen zwischen einem und zwei Drittel. Lokal gab es bedingt durch
kräftige |
|
|
| |
|
Konvektion auch deutliche
positive Abweichungen über dem Doppelten des Schnitts. Bregenz verbesserte
mit |
|
|
| |
|
401 l/m² sogar den 70
Jahre alten Julirekord der Vorarlberger Landeshauptstadt. Der nasseste Platz
fand sich |
|
|
| |
|
allerdings in den Tauern.
Auf der Rudolfshütte akkumulierten sich im Juli 479 l/m². Am auffälligsten
unauffällig |
|
|
| |
|
waren diesen Juli in
Österreich die Temperaturen. Die Hitzewelle der ersten Juliwoche konnte durch
die |
|
|
| |
|
gemäßigten bis kühlen
Werte der folgenden Wochen tatsächlich egalisiert werden. Mit -0,2 °C zum
aktuellen |
|
|
| |
|
Klimanormal 1991-2020 war
der Juli am Ende ziemlich durchschnittlich temperiert. Auf den bergen betrug
die |
|
|
| |
|
Abweichung -0,6 °C. Im
Vergleich zur Referenzperiode 1961-90 zeigte sich jedoch eine positive
Abweichung von |
|
| |
|
+1,5 bzw. +1,0 °C. So
wurde ein durchschnittlicher Juli zum kühlsten seit 2011. Damit gehörte er
trotzdem zum |
|
|
| |
|
wärmsten Fünftel der
österreichischen Messgeschichte seit 1767. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Hintersee ließen die
Temperaturen im Monatsverlauf merklich nach. Starteten wir noch mit Hitze und
einem |
|
|
| |
|
zumindest markant zu
warmen ersten Drittel in den Juli, so fiel der zweite Abschnitt leicht
unterdurchschnittlich |
|
|
| |
|
und das dritte Drittel
um 2 °C zu kühl aus. Die Finaldekade war die kühlste seit 14 Jahren. Daraus
ergab sich ein |
|
| |
|
Monatsmittel von 15,2
°C, das den heurigen Juli um 0,5 °C leicht zu kühl machte. Es handelte sich
dabei um eine |
|
| |
|
im Juli sehr beliebte
Mitteltemperatur, denn diese wurde bereits in den Julimonaten 2002, 2014 und
2017 |
|
|
| |
|
erreicht. Man konnte hier
wirklich von einem breiten Mittelfeld unserer Messreihe sprechen. Zuletzt
kühler war es |
|
|
| |
|
2012 (Mittel: 14,7 °C).
Die Zahl der Sommertage lag mit 8 Tagen um 3 unter schnitt. An heißen Tagen
gab es die |
|
| |
|
beiden
durchschnittlichen gleich zu Monatsbeginn. Mit 31,9 °C ereignete sich hier am
2. Juli auch der Höchstwert |
|
| |
|
des Monats. Sein
Gegenpart trat mit einem Minimum von 8,1 °C am 30. Juli auf. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Regenbilanz wies mit
einer Menge von 344 l/m² einen Überschuss von 39 % auf. Es war der
fünftnasseste |
|
|
| |
|
Juli unserer Messreihe
und der regenreichste seit 2017 (364,5 l/m²). Der Allzeitrekord von 538 l/m²
aus dem Juli |
|
|
| |
|
1997 war aber in weiter
Ferne. 1997 und 2000 zählten wir mit je 25 auch die größte Zahl an
Regentagen. In |
|
|
| |
|
weiteren 5 Jahren waren
es 23 Regentage. Heuer lag diese bei 24 (+5 Tage). Somit hatte der
Niederschlag |
|
|
| |
|
diesen Monat viele
Möglichkeiten sich gut zu verteilen. Die höchste Tagesmenge regnete es mit 72
l/m² am 29. |
|
|
| |
|
Juli. Es war immerhin der
sechstnasseste Julitag an unserer Station. Vom 6. Bis 17. Juli gab es eine
Serie von |
|
|
| |
|
12 Regentagen
hintereinander. Auch ab dem 24. Juli regnete es täglich. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Flaute herrschte bei der
Gewittertätigkeit. An 4 Gewittertagen zählten wir ebenso viele Gewitter. Es
war die |
|
|
| |
|
niedrigste Zahl hinter
den 3 konvektiven Umlagerungen im Juli 2018. Die markanteste Entwicklung trat
dabei am |
|
| |
|
Abend des 16. Julis mit
Starkregen und lebhaften Wind auf. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Monatsrangliste Niederschl. |
>> Monatsvergleich Temp. |
|
| |
|
|
>> Tagesrangliste Regen |
>> Tagestemperaturen |
>> Klimatage |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Tagesrangliste Temp. |
>> Gewitterstatistik |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Di,
29.07.25 |
Sechstnassester
Julitag beendet frischen 6er |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit der sechsthöchsten
Tagesmenge an Regen in einem Juli endete eine kleine Serie an relativ
frischen Tagen |
|
|
| |
|
für den herrschenden
Hochsommer. Schauerartig durchsetzter Dauerregen brachte das erste
nennenswerte |
|
|
| |
|
Niederschlagsereignis in
diesem Jahr. Schon die Tage zuvor zeigten Regenschauer und Wolken der Sonne
die |
|
|
| |
|
kalte Schulter. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Wetterlage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Den Ausgangspunkt nahm
das aktuelle Ereignis am Wochenende. Der Trog eines steuernden Tiefs bei
Island |
|
|
| |
|
hatte sich über die
Britischen Inseln nach Westeuropa ausgedehnt. Durch die schon an den Vortagen
nach |
|
|
| |
|
Westeuropa vorgestoßene
maritime Kaltluft bildete sich über Frankreich ein Ablegertief, das sich am
Samstag |
|
|
| |
|
schon im Bereich der
Toskana aufhielt. Zugleich hatte sich ein Randtief über Südschweden
ausgeformt. Ein Keil |
|
|
| |
|
des Azorenhochs über dem
Ostatlantik griff via Frankreich bis Norddeutschland aus, wurde allerdings
rasch |
|
|
| |
|
wieder abgebaut. Die zum
Tiefsystem im Norden gehörige Kaltfront hatte sich nämlich bereits auf den
Weg |
|
|
| |
|
gemacht. Im Verlauf des
Samstags und der Folgenacht verlagerte sich das Ablegertief allmählich über
die obere |
|
| |
|
Adria zum Balkan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Starkregen im Flachgau |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Im Alpenraum lagerte zu
dieser Zeit noch eine feuchte Luftmasse, die an der Vorderseite des
Italientiefs |
|
|
| |
|
advehiert wurde. Diese
instabile Luftmasse ging am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag
ihrer |
|
|
| |
|
konvektiven Neigung nach.
Mit einem von Bayern bzw. dem Innviertel hereinziehenden Starkregengebiet kam
es |
|
|
| |
|
in Teilen des Flachgaus
zu größeren Regenfällen, die dort stellenweise für Probleme sorgten. Der
Schwerpunkt |
|
|
| |
|
der Niederschläge verlief
dabei vom Seenland bis ins Salzburger Becken, wo zwischen 30 und 60 l/m2 |
|
|
| |
|
zusammenkamen. Am meisten
davon in Mattsee. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Feuerwehreinsätze
Samstagnacht |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
162 Einsatzkräfte von 7
Feuerwehren mussten zu 30 Schadstellen mit überfluteten Straßen oder
vollgelaufenen |
|
|
| |
|
Kellern ausrücken.
Hauptsächlich gab es die Einsätze in der Nacht zu Sonntag in Nussdorf,
Oberndorf und |
|
|
| |
|
Seeham. Sonntagnachmittag
kamen Ausrückungen in Bürmoos und Lamprechtshausen hinzu, da es dort |
|
|
| |
|
abermals kräftige Güsse
gab. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Von Tiefs umklammert |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am Sonntag schlug das
Ablegertief eine nördliche Zugbahn ein und kam bis Tagesende nach Tschechien
voran. |
|
| |
|
In der nordwestlichen
Höhenströmung folgten weitere Schauer. Derweil vollzog sich über den
Westalpen der |
|
|
| |
|
nächste Abtropfprozess
und ein zweites Ablegertief entstand, welches sich bis Montag nach
Mittelitalien |
|
|
| |
|
verschob. Am Montag
verlor das über Polen nordostwärts wandernde erste Ablegertief seinen
direkten Einfluss |
|
|
| |
|
auf unser
Wettergeschehen. Es unterstützte jedoch die nordwestliche Anströmung und
somit erreichte |
|
|
| |
|
schlussendlich die
erwähnte Kaltfront die Alpennordseite. Zugleich kam auch der Trog ostwärts
nach |
|
|
|
| |
|
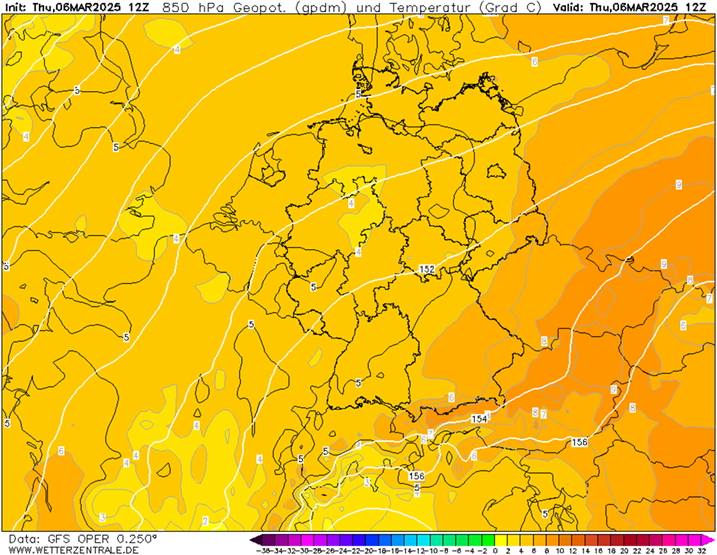
| Mitteleuropa
voran und hinter der Frontpassage tauchten über Süddeutschland immer mehr
Schauer auf. Diese |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
wurden mit dem
Nordwestwind an die Alpen gelenkt. Hier setzte Montagnachmittag allmählich
stärker werdender |
|
| |
|
Dauerregen ein. Von
Montagabend bis Dienstagvormittag regnete es in wechselnder Intensität durch,
ehe der |
|
|
| |
|
Niederschlag von Norden
her in Schauer überging und sich sukzessive in die Staulagen zurückzog. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Bild: Großwetterlage in
Europa zu Montagmittag |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sechstnassester Julitag
mit 72 Litern |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Hintersee war der
erste lokale Starkregen von Samstag auf Sonntag nur eine Randnotiz. Auch der
Sonntag |
|
|
| |
|
selbst und die erste
Tageshälfte des Montags verliefen mit dichter Bewölkung, aus der immer
wieder |
|
|
| |
|
Regenschauer
niedergingen. Aus den Schauern wurde dann im Laufe des Montagnachmittages
allmählich |
|
|
| |
|
Dauerregen. Dieser hielt
in unterschiedlicher Intensität von Montagabend bis zum Diensttagnachmittag
an. |
|
|
| |
|
Phasen mit nur leichten
Regen wechselten sich mit starken Regen ab. Dies brachte in der Nacht zu
Dienstag |
|
|
| |
|
auch die Gräben und
Bäche im Gemeindegebiet zum Anschwellen und es gab ein leichtes Hochwasser.
Lag die |
|
| |
|
Regenmenge am Montag noch
bei beschaulichen 18 l/m² zum abendlichen Messtermin, so regnete es am |
|
|
| |
|
Dienstag 72 l/m². Es war
das größte Niederschlagsereignis seit dem September 2024. Im Juli schafften
wir sogar |
|
| |
|
den Sprung auf den 6.
Rang. Zuletzt mehr regnete es in einem Juli mit 83 l/m² am 17. Juli 2021. Die
Rekorde |
|
|
| |
|
waren jedoch weit weg und
stammen weiterhin aus dem Juli 1997. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Größte Juli-Niederschläge
in Hintersee |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
19.07.1997 |
118,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
06.07.1997 |
116,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
29.07.2019 |
109,5 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4 |
31.07.2014 |
99,5 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5 |
17.07.2021 |
83,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6 |
29.07.2025 |
72,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7 |
11.07.2005 |
69,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
8 |
26.07.2017 |
68,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9 |
05.07.2010 |
67,5 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10 |
08.07.1999 |
65,0 l/m² |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Regenmengen aus Salzburg
und Österreich |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Im Bundesland Salzburg
wies der Norden die höchsten Regenmengen auf. So summierten sich am Dienstag
in |
|
|
| |
|
Faistenau 63,3 l/m², in
St. Koloman 53,8 l/m² und am Gaisberg/Kobenzl 52,2 l/m². Dahinter schwindelte
sich |
|
|
| |
|
Filzmoos mit 47,8 l/m² in
die Reihe vor der Postalm (47,3 l/m²) und Großgmain (46,7 l/m²). Es folgten
Golling |
|
|
| |
|
(46,1 l/m²), Weißbach
(45,3 l/m²), Elsbethen (44,6 l/m²), Abtenau (43,9 l/m²) und Rußbach (40,6
l/m²). Die |
|
|
| |
|
48-stündigen Summen
betrugen in Hintersee 90 l/m², in St. Koloman 85,3 l/m² und in Faistenau 74,9
l/m². |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Salzach erreichte in
der Stadt Salzburg mit einem Pegel von 537 cm immerhin die unterste
Warnstufe, |
|
|
| |
|
sodass die
Radfahrunterführungen der Brücken gesperrt werden mussten. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bundesweit sammelte Weyer
mit 70 l/m² vor Kirchdorf (beide Oberösterreich) mit 61,7 l/m² den
meisten |
|
|
| |
|
Niederschlag. Auf Platz 3
landete Rohrspitz (Vorarlberg) mit 61,4 l/m², gefolgt von
Unterach/Attersee |
|
|
|
| |
|
(Oberösterreich) mit 57,8
l/m². Alle anderen offiziellen Stationen blieben unter der 50er Marke. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Kühlste Juliphase seit 8
Jahren |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Vermutlich sogar mehr
Aufmerksamkeit als der Regen vermochten die Temperaturen auf sich zu ziehen.
Vom |
|
|
| |
|
letzten Donnerstag bis
inklusive Dienstag ketteten sich 6 für Juli kühle Tage aneinander. Mit
Höchstwerten |
|
|
| |
|
zwischen 13,8 °C am
verregneten Dienstag und 16,6 °C an einem stark bewölkten Freitag war es
letztmals vor 8 |
|
| |
|
Jahren ähnlich lange so
frisch. Vom 24. Bis 28. Juli 2017 bewegten sich die Temperaturen zwischen
11,4 und |
|
|
| |
|
16,7 °C. Damals musste
man nach einem Vorgänger nicht lange suchen, denn bis dahin waren solche
kühlen |
|
|
| |
|
Phasen über mehrere Tage
unter 17 °C Tageshöchstwert recht regelmäßig anzutreffen. Beispielsweise
lagen die |
|
| |
|
Höchstwerte zwischen dem
13. Und 17. Juli 2016 zwischen 9,4 und 14,8 °C. Vom 12. Bis 17. Juli 2012
blieb es |
|
|
| |
|
mit Maxima zwischen 13,5
und 15,1 °C ebenso 6 Tage hintereinander kühl. Ein Jahr zuvor pendelte
das |
|
|
| |
|
Thermometer vom 20. Bis
25. Juli 2011 zwischen 9,6 und 16,1 °C. Vom 24. Bis 30. Juli 2010 guckte der
28. Mit |
|
|
| |
|
17,7 °C ein bisschen
hervor. Sein Gegenpart betrug 11,4 °C. Weitere zumindest 5-tägige kühle
Phasen |
|
|
| |
|
ereigneten sich 2009,
2007, 2004 und sogar im so genannten Jahrhundertsommer 2003. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: wetter.orf.at,
www.salzburg24.at, www.salzburg.gv.at, www.wetterzentrale.de |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Tagesrangliste Regen |
>> Tagestemperaturen |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Di,
01.07.25 |
Rückblick
Juni: Wenn er nur sonnt und wärmt, er das regnen verlernt |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 136 l/m² Niederschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 16,7 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 18 Sommertage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 11 Gewitter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ein Zurück zu den Wurzeln
konnte der leicht untertemperierte Mai nicht in die Wege leiten. Schon
der |
|
|
| |
|
abgelaufene Juni schwang
sich wieder auf den Erwärmungszug und bot neben doppelt so vielen |
|
|
|
| |
|
meteorologischen
Sommertagen auch sehr viel Sonnenschein mit einem Sonnenrekord in der
Nachbargemeinde |
|
| |
|
Abtenau. Der dominierende
Hochdruck ließ nur wenig Regen zu und der Juni setzte den 2017 begonnenen 2- |
|
|
| |
|
Jahres-Rhythmus an
unterdurchschnittlich nassen Junimonaten fort. Das erste Halbjahr 2025 riss
dadurch ein |
|
|
| |
|
Niederschlagsdefizit auf,
das es so in den letzten 130 Jahren im Tal von Faistenau und Hintersee nur
einmal |
|
|
| |
|
gab. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Juni startete noch
unter einem über Mitteleuropa abziehenden Hoch. Es folgten mehrere Tiefs über
dem |
|
|
| |
|
europäischen Nordmeer
bzw. bei Island, die neben warmen Vorderseiten auch schwache Regenfronten
mit |
|
|
| |
|
kurzen Abkühlungen
brachten. Zum Ende der ersten Junidekade schob sich ein Azorenhochkeil
allmählich von |
|
|
| |
|
Südwesten heran. Der
Alpenraum befand sich zuerst in einer Westströmung, in der Rußaerosole von
riesigen |
|
|
| |
|
Waldbränden über
Zentralkanada bis nach Mitteleuropa verfrachtet wurden. Die
Rauchkonzentration erreichte |
|
|
| |
|
am 10. Juni ihren
Höhepunkt und sorgte hierzulande für eine markante Lufttrübung. Mit weiterer
Verlagerung des |
|
|
| |
|
Hochs zum Ostseeraum
drehte die Höhenströmung auf Nordost und eine trocken-warme Luft wurde zu
uns |
|
|
| |
|
advehiert. Das vom
zentralen Mittelmeerraum bis Skandinavien reichende Hochdruckgebiet hielt
sich bis zur |
|
|
| |
|
Monatsmitte, ehe ein Tief
bei Schottland wieder für einen kurzen Unterbruch und der Sonne ein
Päuschen |
|
|
| |
|
verschaffte. Gleich mit
Beginn der zweiten Junihälfte ging es allerdings erneut mit Hochdruck weiter,
denn |
|
|
| |
|
abermals breitete sich
ein Keil des Azorenhochs von Südwesten her aus und schlug sein Zentrum über
der |
|
|
| |
|
Nordsee auf. Bis zum
Schwenk in das letzte Junidrittel wanderte dieses Hoch ins östliche
Mitteleuropa und damit |
|
| |
|
änderte sich die
Höhenströmung von einer trocken-warmen auf eine feucht-warme aus Südwest.
Dies passierte |
|
|
| |
|
an der Vorderseite eines
Islandtiefs, das zur Mitte des dritten Monatsdrittels eine schwache Front
mit |
|
|
| |
|
vorlaufenden Gewittern in
den Alpenraum lenkte. Nach einem kurzen Zwischenhoch wiederholte sich
der |
|
|
| |
|
Vorgang. Sehr warme und
schwüle Luft wurde von einer schwachen Kaltfront mit teils kräftigen
Gewittern über |
|
|
| |
|
Österreich bedingt
ausgeräumt. Die letzten Junitage verliefen dann wieder unter Hochdruck, der
sich von |
|
|
| |
|
Südwesten her aufbaute.
Mit der Sonneneinstrahlung wurde es sogleich wieder hochsommerlich temperiert
und |
|
|
| |
|
schwül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Österreich erlebte in
diesem Jahr den drittwärmsten Juni seiner Messgeschichte. Mit einer
Abweichung von +2,9 |
|
| |
|
°C zum Referenzmittel
1991-2020 war es nur mehr in den Junimonaten 2019 und 2003 noch wärmer.
Dabei |
|
|
| |
|
wurde der Wärmeüberschuss
vor allem im Westen und Süden produziert, wo es bis zu 4,5 °C wärmer war als
im |
|
|
| |
|
Mittel. Im Nordosten gab
es kleinere Abweichungen bis zu +2 °C. Auf den Bergen war es mit +3,7 °C
wärmer als |
|
| |
|
im Schnitt. Im Vergleich
zum Klimanormal der Jahre 1961-90 war die Überwärmung mit Abweichungen von
+4,8 |
|
|
| |
|
bzw. +5,7 °C schon enorm.
Lokal erzielten auch Stationen mit Langen Messreihen neue Junirekorde.
Dies |
|
|
| |
|
geschah zum Beispiel in
Klagenfurt (Kärnten, Messungen seit 1813), in Obergurgl (Tirol, 1.941 m, seit
1951) und |
|
| |
|
am Sonnblick (3.105 m,
seit 1887). AM Sonnblick lag das Junimittel mit 5,3 °C um 0,5 °C über dem
alten Rekord |
|
| |
|
aus 2003. Mit gemittelt
10,4 °C bei +4,5 °C Abw. War die Rudolfshütte in 2.304 m der relativ gesehen
wärmste |
|
|
| |
|
Ort diesen Monat. In 45
Orten, bevorzugt in Osttirol und Kärnten gab es neue Junirekorde des
Monatsmittels. Mit |
|
|
| |
|
38,3 °C als
Tageshöchstwert am 26. Juni in Feistritz verzeichnete man in Kärnten einen
neuen |
|
|
|
| |
|
Bundeslandrekord für
Juni. Die Sonne schien diesen Monat um 40 % mehr als im Klimanormal und
machte so |
|
|
| |
|
den diesjährigen Juni zum
zweitsonnigsten hinter dem Juni 2019 (Abw. +47 %). Sehr viele Überstunden
lieferte |
|
|
| |
|
die Sonne dabei in
Salzburg, der Obersteiermark und in den höheren Regionen von Tirol und
Vorarlberg. Hier |
|
|
| |
|
gab es Überschüsse
zwischen der Hälfte und drei Viertel. In Abtenau war es beispielsweise der
sonnigste Juni |
|
|
| |
|
der dortigen
Messgeschichte. Aber auch sonst zeigte sich die Sonne zwischen einem und zwei
Viertel häufiger |
|
|
| |
|
als üblich. Sonnigster
Platz war Bad Radkersburg (Steiermark)mit 348 Stunden. Ein sattes Minus wies
die |
|
|
| |
|
Niederschlagsbilanz auf.
Mit -30 % war der Juni ähnlich trocken wie sein Vorgänger aus 2023.
Deutlich |
|
|
| |
|
niederschlagsärmer fielen
die Juni aus 2019 und 1976 (Abw. -56 %) sowie 1887 (Abw. -57 %) aus. Da es
kaum |
|
|
| |
|
frontalen Landregen gab,
konzentrierte sich die Regenausbeute hauptsächlich auf die Konvektion. Hier
brachten |
|
|
| |
|
teils schwere Gewitter
lokal große Unterschiede. In den gewitterarmen Regionen von Unterkärnten und
der |
|
|
| |
|
Weststeiermark verlief
der Juni mit Einbußen zwischen der Hälfte und 90 % äußerst staubig. Meist lag
das Defizit |
|
| |
|
bei einem Siebtel bis zur
Hälfte. Ausgeglichen bilanzierte das Wiener Becken, das Nordburgenland und
Osttirol. |
|
|
| |
|
Punktuell gab es durch
die erwähnten Gewitter auch Überschüsse. Der nasseste Ort war Tannheim
(Tirol) mit |
|
|
| |
|
182 l/m². |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Hintersee endete der
Juni mit einer Regensumme von 136 l/m² bei einem Minus von 39 % relativ
trocken. Er |
|
|
| |
|
klassierte sich damit in
unteren Drittel unserer Messreihe, in der sich mit 2017, 2019, 2021 und 2023
auffällig |
|
|
| |
|
viele Junimonate der
jüngeren Zeit tummeln. Seit 2017 gibt es einen interessanten jährlichen
Wechsel zwischen |
|
|
| |
|
einem trockenen und einem
durchschnittlich nassen Juni. Die Monatssumme verteilte sich dabei auf
13 |
|
|
| |
|
Regentage (-5 Tage). Am
meisten regnete es mit 29 l/m² am 8. Juni. Dafür blieb es vom 9. Bis zum 14.
Sowie |
|
|
| |
|
vom 17. Bis zum 22. Juni
jeweils 6 Tage hintereinander niederschlagsfrei. Wenn man bedenkt, dass die
längste |
|
|
| |
|
Trockenphase in einem
Juni 8 Tage (23.-30. Juni 2019) dauerte, durchaus bemerkenswert. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die bislang sehr maue
Gewittertätigkeit in diesem Jahr fand im Juni vorerst ihre Fortsetzung. Eine
Ausnahme |
|
|
| |
|
bildete da ein Wetter mit
Starkregen und lebhaften Wind am späten Abend des 3. Junis. Recht
gewitterträchtig |
|
|
| |
|
war hingegen der 26.
Juni, an dem nachmittags und abends 5 Zellen in unterschiedlicher Intensität
über das |
|
|
| |
|
Gemeindegebiet
hinwegzogen. Insgesamt zählten wir im Juni an 5 Gewittertagen 11 Zellen. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ausgesprochen negativ ins
Auge sticht die Niederschlagsbilanz des ersten Halbjahres 2025. Mit einer
Menge |
|
|
| |
|
von lediglich 664,5 l/m²
haben wir ein riesiges Defizit von 40,8 % aufgerissen. In Litern sind das
schon 457,7. In |
|
|
| |
|
der Hinterseer Messreihe
war bisher noch keine erste Jahreshälfte auch nur annähernd so trocken.
Viel |
|
|
| |
|
Niederschlag gab es
dagegen zwischen Jänner und Juni 2013, das mit 1.504,5 l/m² bei einer
Abweichung von |
|
|
| |
|
+34,1 % unsere Rangliste
anführt. Knapp dahinter 2012 mit 1.492,5 l/m² bei +33 %. Zur Einordnung
des |
|
|
| |
|
aktuellen Defizits
bemühen wir deshalb zusätzlich die 130-jährige Messgeschichte der
Hydrografischen Station in |
|
| |
|
Faistenau. Hier zeigt
sich das Ausmaß der heurigen Niederschlagsarmut mehr als deutlich. Im
Vergleich zur |
|
|
| |
|
Referenzperiode 1991-2020
war es einzig im ersten Halbjahr von Jänner bis Juni 1934 mit einer
Abweichung |
|
|
| |
|
von -42,9 % noch ein
Stück trockener als heuer. Weitere große Niederschlagsdefizite gab es in den
ersten |
|
|
| |
|
Jahreshälften 1901 (Abw.
-34,3 %), 1963 (Abw. -33 %), 1918 (Abw. -32,7 %) und 1991 (Abw. -30,1 % (.
Am |
|
|
| |
|
nassesten war es übrigens
an dieser Station in der ersten Jahreshälfte 1910 mit +35,2 %. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Wie schon in der
bundesweiten Auswertung war es auch in Hintersee der drittwärmste Juni. Das
Monatsmittel |
|
|
| |
|
betrug 16,7 °C und lag
damit um 2,2 °C über dem langjährigen Schnitt. Mit Respektabstand hinter 2003
(Mittel: |
|
|
| |
|
17,7 °C) und 2019
(Mittel. 17,6 °C) errang der heurige Juni den untersten Stockerlplatz. Das
Duo 2021 und 2022 |
|
| |
|
(Mittel: 16,4 °C) wurde
auf den geteilten 4. Platz verdrängt. In der Liste aller Monate verpasste der
Juni 2025, ex |
|
|
| |
|
aequo mit dem Juli 2018
auf Rang 11 liegend, die Top 10 nur knapp. Der Wärmeüberschuss zog sich
heuer |
|
|
| |
|
durch den ganzen Monat.
In den ersten beiden Junidritteln war es um 2 Grad, in der dritten Dekade um
3 Grad |
|
|
| |
|
zu warm. Das höchste
Tagesmaximum gab es mit 30,6 °C am 15. Juni. Es war einer von 3 Hitzetagen
(+1 Tag). |
|
|
| |
|
Hinzu gesellten sich 4
weitere Tage, an denen es zumindest 29 °C hatte. Die Anzahl der Sommertage
war mit 18 |
|
| |
|
doppelt so hoch als
üblich (+9 Tage). Mehr Sommertage gab es mit jeweils 21 nur in den
Junimonaten 2003 und |
|
| |
|
2019. Einen kalten Tag
gab es wiederum nicht. Früher regelmäßig, sind diese seit 2013 im Juni
verschwunden. |
|
|
| |
|
Am tiefsten sank das
Thermometer mit 8,1 °C am 9. Juni. Mit einem Minimum von 15,7 °C am 28. Juni
landeten |
|
|
| |
|
wir auch eine Platzierung
unter den 10 mildesten Juniminima. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at,
www.uwz.at |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Tagestemperaturen |
>> Monatsrangliste Temp. |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Tagesrangliste Temp. |
>> Klimatage |
|
| |
|
|
>> Monatsrangliste Niederschl. |
>> Monatsvergleich Temp. |
>> Gewitterstatistik |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mo,
02.06.25 |
Rückblick
Mai: Weht der Wind aus Nord, kommts Kühl mit Regen an Bord |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 198 l/m² Niederschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 9,8 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 26,8 °C Tageshöchstwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 1 Gewitter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Für den Mai 2025 müsste
man eigentlich Artenschutz beantragen. War es doch seit 2 Jahren der erste
etwas |
|
|
| |
|
unterkühlte Monat und der
dritte seit 2022. Witterungstechnisch schwenkte er im Monatsverlauf den Hut
und |
|
|
| |
|
verabschiedete sich von
dem Charakter der Vormonate. Abgesehen von Beginn und Ende war es im Mai
mit |
|
|
| |
|
Nordlagen kühl bis
gemäßigt warm. Zudem brachte Tiefdruckeinfluss wiederholt Regen in
verdaubaren |
|
|
| |
|
Portionen. Mit dem Mai
endete auch der meteorologische Frühling, welcher ein markantes
Niederschlagsdefizit |
|
|
| |
|
hinterließ und der
drittwärmste der Hinterseer Messreihe wurde. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Einstand des dritten
Frühlingsmonats ging unter breiten Hochdruck einher. Dieser erstreckte sich
von der |
|
|
| |
|
Iberischen Halbinsel über
die Britischen Inseln bis Skandinavien und weiter südlich bis zum
Schwarzmeerraum. |
|
|
| |
|
Der Tiefdruck war nord-
und südwärts abgelenkt. Hierzulande herrschte bei trocken-warmer Luft
freundliches |
|
|
| |
|
Wetter. Zur Mitte der
ersten Maidekade jedoch drängte Tiefdruck von Island kommend den Hochdruck
aus |
|
|
| |
|
Mitteleuropa ab. Dieser
zog sich ortsfest zu den Britischen Inseln zurück, während sich der steuernde
Tiefdruck |
|
|
| |
|
über Nordosteuropa
einrichtete. Auf dessen Rückseite kam frische Luft polaren Ursprungs für
einige Tage zu |
|
|
| |
|
uns, wodurch es auf den
Bergen wieder etwas Neuschnee gab. Die vorstoßende Kaltluft verursachte
zudem |
|
|
| |
|
Tiefdrucktätigkeit im
Mittelmeerraum. Mit Schwenk in das Mitteldrittel wurde der Trog ein Stück
nach Osten |
|
|
| |
|
weggeschoben. Das Hoch
über der Nordsee dehnte sich bis Mitteleuropa und weiter zum zentralen |
|
|
|
| |
|
Mittelmeerraum aus. Bis
zur Maimitte brachte dies ein paar sonnige, aber in der nördlichen Strömung
auch |
|
|
| |
|
gemäßigt temperierte
Tage. Im Anschluss erfuhr das nordwesteuropäische Hoch eine retrograde
Verlagerung |
|
|
| |
|
unter Ausdehnung nach
Island bzw. zur Iberischen Halbinsel. Dies gab dem nach wie vor über dem
baltischen |
|
|
| |
|
raum liegenden Tiefdruck
die Chance, sich ebenfalls westwärts zu schieben und den Alpenraum wieder
unter |
|
|
| |
|
seine Fittiche zu nehmen.
In eher trocken-kühler Polarluft zogen schwache Fronten mit geringen
Niederschlägen |
|
|
| |
|
durch. Mit Wechsel in die
dritte Maidekade zog sich der blockierende Hochdruck noch weiter in Richtung
Island |
|
|
| |
|
zurück. Das gab einem
kleinen Tief über Westeuropa die Gelegenheit, sich auf den Kontinent voran
zu |
|
|
| |
|
schleichen. Mit
feucht-milder Luft aus Südwest blieb es im Alpenraum anhaltend unbeständig.
Als Italientief |
|
|
| |
|
gekleidet beeinflusste es
unter Ostverlagerung noch ein paar Tage unser Wetter, ehe sich für die
letzte |
|
|
| |
|
Maiwoche der Atlantik
nach längerer Zeit Gehör verschaffte. Zuvor redete allerdings noch ein Tief
über |
|
|
| |
|
Südschweden mit, ehe sich
das Hoch über dem Ostatlantik etwas südwärts zurückzog und Tiefdruck
zwischen |
|
|
| |
|
Island und Schottland
Platz machte. Aus dieser Richtung erreichten in einer nordwestlichen bis
westlichen |
|
|
| |
|
Strömung wiederholt
Fronten den Alpenraum, unterbrochen von kurzen Zwischenhochphasen durch
einen |
|
|
| |
|
Azorenhochkeil. Ganz zum
Schluss brachte dieser eine warme Luftmasse aus Südwest herbei und der
letzte |
|
|
| |
|
Maitag verlief sommerlich
warm. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Österreich
präsentierte sich der heurige Mai im Tiefland mit einer Abweichung von -0,9
°C der |
|
|
|
| |
|
Mitteltemperatur zur
Referenzperiode 1991-2020 zu kühl. Auch auf den Bergen blieben die
Temperaturen um 1,1 |
|
| |
|
°C unter dem Normal. Im
Vergleich zum Klimamittel 1961-90 war der Mai hingegen mit +0,5 bzw. +0,7 °C
etwas |
|
|
| |
|
zu warm. Bundesweit
zeigte sich heuer ein Temperaturgefälle, das einen ausgeglichenen Westen und
Süden |
|
|
| |
|
von einem markant zu
frischen Nordosten trennte. Ähnlich gestaltete sich die Verteilung beim
Niederschlag. |
|
|
| |
|
Während es vom Flachgau
ostwärts ein Minus zwischen einem Siebtel und der Hälfte, lokal bis zu zwei
Drittel, |
|
|
| |
|
gab, verlief der Mai von
Vorarlberg bis ins Salzburger Innergebirg und Kärnten um die gleichen Werte
zu nass. |
|
|
| |
|
Bundesweit ermittelte
sich dadurch ein leichtes Plus von 7 %. Nassester Platz war die Rudolfshütte
mit 314 l/m². |
|
|
| |
|
Wieder einmal unter dem
Soll bilanzierte die Sonnenscheindauer. Mit -19 % war der heurige Mai der
nächste in |
|
|
| |
|
einer Serie von weniger
sonnigen Maimonaten, die seit 2013 auftraten (Ausnahmen 2017 und 2018). Bis
zu |
|
|
| |
|
einem guten Drittel
weniger schien die Sonne entlang des Alpenhauptkamms. Ansonsten betrug das
Defizit bis |
|
|
| |
|
zu einem Viertel.
Ausgeglichen war die Sonnendauer einzig im oberösterreichischen Flachland und
im |
|
|
| |
|
Waldviertel. Mit Enns
(Oberösterreich) und 226 Sonnenstunden lag der sonnenreichste Ort wenig
verwunderlich |
|
|
| |
|
genau dort. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
An unserer Station in
Hintersee zeigte sich beim Niederschlag mit 198 l/m² und einem leichten Minus
von 14 % |
|
|
| |
|
ein durchaus
ausgeglichener Mai. Die heurige Monatsmenge entsprach fast genau jener aus
dem Vorjahr (196 |
|
|
| |
|
l/m²)). Allgemein wies
der Mai seitdem sehr trockenen aus 2018 (104 l/m²) und dem nassen 2019 (320,5
l/m²) |
|
|
| |
|
tage. Diese lag heuer mit
20 exakt im langjährigen Mittel, um das es seit 10 Jahren ebenfalls keine
größeren |
|
|
| |
|
Abweichungen gab.
Niederschlagsreichster Tag war mit 29,5 l/m² der 29. Mai. Von 10. Bis 14. Mai
gab es eine 5- |
|
| |
|
tägige Trockenphase. Am
3. Mai endete eine 7 Tage andauernde niederschlagsfreie Woche, die am 27.
April |
|
|
| |
|
begonnen hatte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Aufgrund der oftmals
dominierenden kühlen und wenig energiereichen Luftmassen aus dem Norden blieb
die |
|
|
| |
|
Gewittertätigkeit auf
äußerster Sparflamme. Einzig am Abend des 26. Mai donnerte es einmal inmitten
eines |
|
|
| |
|
kurzen starken
Regenschauers. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ganz aus blieb diesen Mai
das 6. Mal in Folge auch Neuschnee. Darum entsprach die erwähnte
Niederschlags- |
|
|
| |
|
auch der Regenmenge im
Mai. Mit -7 % lag sie recht gut beim Schnitt und der Mai 2025 landete damit
im |
|
|
| |
|
Mittelfeld.
Regenreichster Tag war der angeführte
29. Mai-. Die Zahl der 20 Regentage lag 1 unter dem Mittel. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bei den Temperaturen
sorgte der heurige Mai für ein selten gewordenes Bild. Erstmals seit 2 Jahren
an |
|
|
| |
|
durchgehend, teils
extrem, zu warmen Monaten fiel ein Monat wieder einmal mit einer leicht
negativen |
|
|
| |
|
Abweichung auf. Der Mai
hatte eine Mitteltemperatur von 9,8 °C bei einer Abweichung von -0,7 °C
zum |
|
|
| |
|
langjährigen Schnitt.
Dabei stieg das Minus im Monatsverlauf an. Von -0,4 °C in der ersten bis -1,1
°C in der |
|
|
| |
|
dritten Maidekade. Der
Mai 2025 platzierte sich damit gemeinsam mit dem Mai 2020 im Mittelfeld
aller |
|
|
| |
|
Maimonate. Letztmals
kühler war der Mai vor 4 Jahren (Mittel: 9 °C). Der letzte Monat mit
einer |
|
|
|
| |
|
Negativabweichung beim
Monatsmittel war der April 2023 und davor musste man auch schon ein Jahr
warten, |
|
|
| |
|
um einen zu kühlen Monat
erlebt zu haben. Auffällig war heuer außerdem, dass es von April zu Mai kaum
eine |
|
|
| |
|
Erwärmung gab. Steigt die
Mitteltemperatur normalerweise von April auf Mai um 4 °C an, so lagen
heuer |
|
|
| |
|
zwischen den beiden
Monaten nur 0,6 °C. Genau so verhielt es sich 2020. April und Mai waren
damals genau |
|
|
| |
|
gleich temperiert. 2019
betrug die Steigerung ebenso nur 0,8 °C, fand allerdings auf einem deutlich
niedrigeren |
|
|
| |
|
Niveau statt. Wir zählten
diesen Mai durchschnittliche 5 kalte tage und 1 Sommertag (-2 Tage). Am
höchsten |
|
|
| |
|
kletterte das
Thermometer am 31. Mai mit 26,8 °C. Am frischesten war es mit einem Minimum
von 1,9 °C am 10. |
|
| |
|
Mai. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der leicht unterkühlte
Mai, und sehr warme März und April bildeten mit einem Mittel von 7,9 °C bei
einer |
|
|
| |
|
Abweichung von +1,6 °C
den drittwärmsten Frühling in Hintersee. Geschlagen nur vom Rekord (8,8 °C)
aus dem |
|
|
| |
|
Vorjahr und dem Frühjahr
2018 (8,2 °C). Dabei boten März und April viel Sonnenschein, Wärme und |
|
|
|
| |
|
Trockenheit, die in der
ersten Maihälfte ein Ende fanden und sich hin zu kühlen und wechselhaften
Wetter |
|
|
| |
|
drehten. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dennoch fiel der Frühling
2025 mit einer Niederschlagssumme von 412,5 l/m² um 19 % trockener aus und
war |
|
|
| |
|
damit um fast ein Drittel
niederschlagsärmer wie der Lenz 2024. Auch Schnee war praktisch kein Thema
mehr |
|
|
| |
|
und die 6 schneefalltage
(-8 Tage) waren die drittwenigsten hinter 2002 (5 Tage) und 1999 (3 Tage).
Die 44 |
|
|
| |
|
Regentage lagen um 4
unter dem Soll. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Österreich hielt sich
die Niederschlagsbilanz im Frühling 2025 mit +3 % Abweichung gut an das
langjährige |
|
|
| |
|
Mittel. Dabei zeigte sich
die Alpennordseite mit Einbußen bis 50 %, wie etwa im Flachgau oder dem
Innviertel, |
|
|
| |
|
auf der trockenen Seite.
Entlang und südlich des Alpenhauptkamms gab es Zugewinne bis zu einem
Drittel. |
|
|
| |
|
Nassester Platz war der
Loiblpass (Kärnten) mit 700 l/m². Die niederschlagsarmen Regionen bekamen
dafür bis |
|
| |
|
zu einem Fünftel mehr an
Sonnenschein. In den feuchteren Gebieten war es hingegen bis zu einem
Viertel |
|
|
| |
|
weniger. Bundesweit
ermittelte sich daraus ein kleines Plus von 2 %. Sonnenreichster Ort im Lenz
war Andau |
|
|
| |
|
(Burgenland) mit 637
Stunden. Die Temperaturen lagen herunten im Vergleich zum aktuellen
Klimamittel 1991- |
|
|
| |
|
2020 um 0,9 °C höher, was
den 12. Platz in der österreichischen Messgeschichte bedeutete. Auf den
Bergen |
|
|
| |
|
war es mit +1,1 °C und
dem 6. Rang ein Stück wärmer. In Bezug auf die Referenzperiode 1961-90
betrugen die |
|
|
| |
|
Abweichungen +2,3 bzw.
+2,6 °C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Frühlingsvergleich |
>> Klimatage |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Tagestemperaturen |
>> Frühlingsvergleich Temp. |
|
| |
|
|
>> Monatsrangliste Niederschl. |
>> Monatsvergleich Temp. |
>> Gewitterstatistik |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Fr,
02.05.25 |
Vorläufige
Winterbilanz 2024/25 |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 157,5 cm Neuschneesumme |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 99 Schneedeckentage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 10 Eistage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 0,5 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Rückschau auf den
vergangenen Winter 2024/25 zeigte eine von zahlreichen Hochdrucklagen
bestimmte |
|
|
| |
|
„kalte“ Jahreszeit. Die
Anführungszeichen waren aber mehr als berechtigt, denn im Gegensatz zu |
|
|
|
| |
|
hochdruckdominierten
Wintern alten Schlages war der Winter 2024/25 sehr mild und lag 2 °C über
dem |
|
|
| |
|
heimischen Normal. Als
Sechstmildesten fehlten ihm 3 Wochen Dauerfrost. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der große Abwesende
diesen Winter war jedoch der Schnee. Mit einer Neuschneesumme von gut
eineinhalb |
|
|
| |
|
Metern und 29 % des Solls
bilanzierte der Winter 2024/25 als schneeärmster seit 35 Jahren. Im Tal fiel
damit |
|
|
| |
|
lediglich eine
Schneemenge, die sich bei einem kräftigen Wintereinbruch Mitte September auf
unseren Bergen |
|
|
| |
|
binnen weniger Tage
ansammelte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Startschuss in die
Wintersaison 2024/25 fiel außerordentlich früh im erst begonnenen
meteorologischen |
|
|
| |
|
Herbst. Im Zuge eines
mächtigen Niederschlagsereignisses schneite es am 12. September den
ersten |
|
|
| |
|
Zentimeter ins Tal,
wodurch sich zugleich der erste Schneedeckentag einstellte. In den Wochen
danach |
|
|
| |
|
übernahm zusehends der
Hochdruck das Kommando und der weitere September sowie der gesamte
Oktober |
|
|
| |
|
verliefen ohne
winterliche Anzeichen. Der Oktober war zum wiederholten Male ungemein warm.
Trockenes und |
|
|
| |
|
recht mildes Herbstwetter
brachte der November, ehe er im letzten Drittel unbeständig wurde.
Leichte |
|
|
| |
|
Schneefälle und die
Ausbildung einer dezenten Schneedecke folgten. So ging es im Dezember weiter,
wo die |
|
|
| |
|
Hochdruckphasen mit
Fortdauer des Monats erneut zunahmen. Im schneeärmsten Jänner seit 2008 und
dem |
|
|
| |
|
trockensten Februar seit
4 Jahrzehnten ließen stabile Hochdruckgebiete kaum Platz für Schneefälle,
die |
|
|
| |
|
entsprechend marginal
ausfielen. Dennoch konnte die dünne Schneedecke verhältnismäßig gut
konserviert und |
|
|
| |
|
bis zu einem
Wärmeeinbruch Ende Februar gerettet werden. Mit kraftvoller Wärme setzte der
März die |
|
|
| |
|
antizyklonale Dominanz im
Wettergeschehen fort, sodass der Winter abermals keine Chance vor fand.
Den |
|
|
| |
|
abschließenden weißen
Tupfer des Winters 2024/25 gab es mit dem letzten Schneefalltag und 6 cm am
1. April. |
|
|
| |
|
An diesem Tag war zudem
die Schneedecke letztmals Gast. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Neuschneesumme
betrug im abgelaufenen Winter 157,5 cm. Mit -71 % war es der schneeärmste
Winter seit |
|
| |
|
35 Jahren. Gemeinsam mit
den Wintern 2022/23 (333,5 cm) und dem Vorwinter 2023/24 (314,5 cm) war es
der |
|
|
| |
|
dritte Winter in Folge
mit einem teils sehr großen Schneedefizit. Die Reihe ähnelte den schneearmen
Wintern der |
|
| |
|
späten 1980er und frühen
1990er Jahre, wo es 1988/89 260 cm, 1989/90 144 cm und 1990/91 353 cm |
|
|
| |
|
Neuschnee gab. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Den ersten Schnee gab es
mit 2,5 cm im September zwar sehr früh in der Saison, es folgte ihm
allerdings ein |
|
|
| |
|
schneefreier Oktober und
auch der November war mit 32 cm kein großer Meister seines Fachs. Den
Löwenanteil |
|
| |
|
der Wintersumme
fabrizierte mit 53,5 cm der Dezember. Im Jänner (33,5 cm), Februar (17,5 cm
(, März (12,5 |
|
|
| |
|
cm) und im April (6 cm)
waren die Neuschneemengen nicht der Rede wert. Mit Ausnahme des
Septembers |
|
|
| |
|
bilanzierten die
schneebringenden Monate mit sehr großen Einbußen zwischen 47 und 87 %. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Zahl der
Schneefalltage lag mit 46 um 10 Tage unter dem langjährigen Schnitt und
entsprach damit den |
|
|
| |
|
beiden Vorwintern, die
jeweils 45 Schneefalltage anboten. AM häufigsten schneite es mit 14
Schneefalltagen |
|
|
| |
|
noch im Dezember,
November und Jänner hatten 8 Schneefalltage, der Februar 7, der März 5, der
September |
|
|
| |
|
für seine Begriffe
zahlreiche 3 und der April noch 1 tag. Das größte Schneefallereignis hielt
sich für die hiesigen |
|
|
| |
|
Verhältnisse im Rahmen
der Bedeutungslosigkeit und ging am 3. Jänner mit 16 cm Neuschnee einher. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am selben Tag erreichte
die Schneedecke an unserer Station mit kargen 38 cm ihre maximale Höhe.
Die |
|
|
| |
|
Schneedeckenzeit
erstreckte sich vom ersten Schneedeckentag am 12. September bis zum letzten
am 1. April. |
|
|
| |
|
Die längste Periode mit
einer geschlossenen Schneedecke dauerte vom 20. November bis zum 22.
Februar. |
|
|
| |
|
Dezember und Jänner
schöpften die größtmögliche Tageszahl aus, der Februar schwächelte bereits
mit 22, im |
|
|
| |
|
November verzeichneten
wir immerhin noch 11 Schneedeckentage. Im März war es beinahe dauerhaft aper
und |
|
|
| |
|
mit nur 2
Schneedeckentagen egalisierten wir den erst 2024 aufgestellten Negativrekord.
Ein kosmetischer |
|
|
| |
|
Beitrag war der jeweils
eine Schneedeckentag im September und April. Insgesamt gab es diesen Winter
an |
|
|
| |
|
unserer Station 99 Tage
mit geschlossener Schneedecke, um 17 unter dem Soll. Nach den Minusleistungen
der |
|
|
| |
|
Winter 2022/23 (89 Tage)
und 2023/24 (79 Tage) schafften wir zum dritten Mal hintereinander die
100-tage- |
|
|
| |
|
Marke nicht mehr. Im
tiefer gelegenen Ortsteil Oberasch war die Schneedecke deutlich weniger oft
anwesend. |
|
|
| |
|
Ein Kuriosum war, dass
die größte Schneehöhe auf den Bergen bereits durch die Starkniederschläge
Mitte |
|
|
| |
|
September erzielt wurde.
Am 15. September hatten sich zwischen einem halben und eineinhalb Meter
Schnee |
|
|
| |
|
angehäuft. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mangelware war im Winter
2024/25 auch die Kälte. Zwar war das Fehlen winterlicher Temperaturen nicht
derart |
|
|
| |
|
extrem ausgeprägt wie im
Vorwinter, dennoch überwiegten auch diesmal die milden bis sehr milden
Phasen. Mit |
|
| |
|
87 Frosttagen gab es um
21 weniger als üblich. Im Vergleich zur Wintersaison 2023/24 ein Anstieg um
35 Tage |
|
|
| |
|
und trotzdem der
viertniedrigste Wert der Messreihe hinter 2022/23 (80 Frosttage) und 2015/16
(75 Frosttage. |
|
|
| |
|
Die Verteilung betraute
den November mit 13, den Dezember mit 21, den Jänner mit 22, den Februar mit
18, den |
|
| |
|
März mit 9 und den April
noch mit 4 Frosttagen. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Gering war ebenfalls die
Anzahl der Eistage, die mit 10 Tagen nur 3 Winter hinter sich ließ. Zum
Schnitt fehlten |
|
|
| |
|
uns 20 Eistage. Noch
kläglicher sah es in den Wintern 2013/14 und 2015/16 mit je 8 Eistagen sowie
im Winter |
|
|
| |
|
2019/20 mit 1 Eistag
aus. Sogar der „Hitzewinter“ 2023/24 brachte es auf 12 Eistage. Demnach gab
es nicht viel |
|
| |
|
aufzuteilen. Der Jänner
staubte mit 5 Eistagen noch die meisten ab, im Februar waren es 3, November
und |
|
|
| |
|
Dezember bekamen jeweils
nur 1 Eistag ab. Im Dezember war dies nach dem Totalausfall 2015 der |
|
|
|
| |
|
zweitniedrigste Wert. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die gemittelte Temperatur
des meteorologischen Winters von Dezember bis Februar reihte den Winter
2024/25 |
|
|
| |
|
mit 0,5 °C bei einer
Abweichung von +2,0 °C auf dem 6. Platz ein. Der rekordhaltende Vorwinter war
um 1,3 °C |
|
|
| |
|
milder. Kein Wintermonat
erreichte diesmal eine negative Mitteltemperatur. Die tiefste Temperatur trat
mit -9,6 °C |
|
| |
|
am 19. Februar auf. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Erweitert um die Monate
November und März betrug das Mittel 1,9 °C und lag genau um diesen Wert über
den |
|
|
| |
|
Schnitt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Wintervergleich Neuschnee |
>> Wintervergleich Temp. |
>> Winterstatistik |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mi,
30.04.25 |
Rückblick
April: Sehr warme und trockene Frühlingsmitte |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 51,5 l/m² Niederschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 6 cm Neuschnee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 9,2 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 25,1 °C drittfrühester
Sommertag |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Das Aprilwetter war in
diesem Jahr alles andere als abwechslungsreich. Der zentrale Frühlingsmonat
brillierte |
|
|
| |
|
vor allem in seiner Mitte
mit enormer Tages- und Nachtwärme, die ihn zum drittwärmsten April in
Hintersee |
|
|
| |
|
machte. Im trockensten
April seit 12 Jahren fiel wenig Regen und noch weniger Schnee. Dafür gab es
die |
|
|
| |
|
höchste Zahl
niederschlagsfreier tage eines Aprils, gepaart mit einer ordentlichen Portion
Sonne, Föhn und |
|
|
| |
|
Saharastaub. Der Abschluss des ersten Jahresdrittels
2025 verstärkte das Niederschlagsdefizit weiter. Es fehlen |
|
| |
|
50,5 % zum langjährigen
Schnitt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Beginn des Aprils
stand zwischen zwei Hochdruckzonen über dem Atlantik und Westrussland
unter |
|
|
| |
|
nachlassendem
Tiefdruckeinfluss, da sich ein Nordseetief über den Ostalpenraum südwärts
verlagerte. Während |
|
| |
|
des ersten Monatsdrittels
dehnte sich der atlantische Hochdruck aus und bildete ein separates Hoch über
der |
|
|
| |
|
Nordsee. AN dessen
Ostflanke gerieten wir in den Randbereich einer kalten Nordostströmung. Bis
zum ersten |
|
|
| |
|
Dekadenwechsel drückte
jedoch das Hoch den osteuropäischen Trog weg und eine Erwärmung setzte ein.
Zum |
|
|
| |
|
Start in das zweite
Aprildrittel befand sich der Schwerpunkt des Hochs über Südosteuropa. Ein
Island- und ein |
|
|
| |
|
Biscayatief sorgten für
das Aufkommen einer föhnigen und warmen Südwestströmung. Diese fand in
der |
|
|
| |
|
Karwoche ihren Höhepunkt.
Getrieben von mehreren Tiefs, die im Westeuropatrog zwischen den
Britischen |
|
|
| |
|
Inseln und dem westlichen
Mittelmeerraum wirbelten, kam es zu einer straffen Südströmung, in der
subtropische |
|
|
| |
|
Warmluft samt Saharastaub
herantransportiert wurde. Diese stützte eine Hochdruckzone mit Kern bei
Finnland, |
|
|
| |
|
die von Skandinavien bis
zum östlichen Mittelmeerraum reichte. Neben frühsommerlichen Temperaturen
blies an |
|
| |
|
der Alpennordseite ein
Föhnsturm. Aus dem Trog löste sich ein nordostwärts ziehendes Italientief,
das am |
|
|
| |
|
Karfreitag nach einer
zweiwöchigen Trockenphase etwas Niederschlag brachte. Doch schon die
Osterfeiertage |
|
|
| |
|
verliefen erneut unter
Hochdruckeinfluss und die Strömung schwenkte durch ein nordostwärts
wanderndes |
|
|
| |
|
Biscayatief auf Südwest
zurück, verbunden mit der Zufuhr von Saharastaub. Beim Schwenk in das
letzte |
|
|
| |
|
Aprildrittel lag der
Alpenraum weiterhin zwischen dem Trog im Westen und dem Hochdruckgebiet im
Osten |
|
|
| |
|
Europas. Zur Mitte der
Schlussdekade setzte sich der Tiefdruck in Bewegung und mit einem Ablegertief
über |
|
|
| |
|
dem Balkan fiel an ein
paar Tagen Niederschlag. Dahinter breitete sich vom europäischen Nordmeer
das |
|
|
| |
|
nächste umfangreiche
Hochdruckgebiet zum Ostseeraum hin aus. Ein Flüchtling des Ostatlantiktroges
wurde |
|
|
| |
|
über Frankreich am
letzten Aprilwochenende in den Mittelmeerraum abgelenkt, sodass sich
hierzulande |
|
|
| |
|
wiederum antizyklonal
dominiertes Wetter in einer sehr milden bis warmen Nordostströmung
durchsetzte. Diese |
|
|
| |
|
blieb bis zum Monatsende
von Bestand, weil sich der Hochdruck bis zur Iberischen Halbinsel, den
Britischen |
|
|
| |
|
Inseln und dem
Schwarzmeerraum ausweiten konnte. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Folge der zahlreichen
Hochlagen war das Ausbleiben von Niederschlag an der Alpennordseite. SO fiel
das |
|
|
| |
|
Defizit von Vorarlberg
bis zum Innviertel mit der Hälfte bis einem Fünftel des Erwartbaren sehr
mager aus. Etwas |
|
| |
|
weniger ausgeprägt war
das Minus mit einem Drittel bis zur Hälfte im Pinz- und Pongau. Bis zu einem
Drittel |
|
|
| |
|
unter Soll betrugen die
Monatsmengen im Lungau und Kärnten. Der Rest des Landes war ausgeglichen,
lokal in |
|
|
| |
|
Osttirol und
Nordburgenland sogar leicht überdurchschnittlich. Südlich und östlich der
Alpen sorgten die |
|
|
| |
|
Italientiefs für eine
Aufbesserung der Bilanz, die österreichweit mit -30 % einen eher trockenen
April hinterließ. |
|
|
| |
|
Nassester Ort war der
Loiblpass (Kärnten) mit 164 l/m². Die niederschlagsärmsten Regionen waren in
Österreich |
|
| |
|
dafür die sonnenreichsten
mit Überschüssen bis zu einem Drittel. Negative Abweichungen bis zu einem
Viertel |
|
|
| |
|
gab es im Süden,
ansonsten schien die Sonne durchschnittlich lang. Bundesweit lag die
Sonnenscheindauer 7 |
|
|
| |
|
% über Schnitt.
Sonnenreichster Platz war Feldkirch (Vorarlberg) mit 250 Stunden. Bis auf
einzelne Tage im |
|
|
| |
|
ersten Aprildrittel
blieben kältere Tage diesen Monat aus. So wurde der April 2025 mit einer
Abweichung von |
|
|
| |
|
+1,9 °C zum
Referenzmittel 1991-2020 zum neuntwärmsten der österreichischen
Messgeschichte. Auf den |
|
|
| |
|
Bergen eroberte er mit
+2,0 °C Abw. Den 8. Platz. Im Vergleich zur Klimanormalperiode 1961-90
betrugen die |
|
|
| |
|
Abweichungen +3,4 bzw.
+3,6 °C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Hintersee zogen die
Temperaturen deutlicher an als im Österreichschnitt. An unserer Station war
es mit einem |
|
| |
|
Monatsmittel von 9,2 °C
bei einer Abweichung von +2,9 °C der gemeinsam mit 2020 drittwärmste April
unserer |
|
|
| |
|
Messreihe. Geschlagen nur
von den Aprilmonaten aus 2018 (Mittel: 10,0 °C) und 2011 (Mittel: 9,3 °C).
Dabei |
|
|
| |
|
begann der heurige April
im ersten Monatsdrittel noch völlig unauffällig, legte im Mitteldrittel mit
einer krassen |
|
|
| |
|
Abweichung von +6,0 °C
einen neuen Dekadenrekord hin und endete in der Schlussdekade wiederum
deutlich |
|
|
| |
|
zu warm. Den bisherigen
Rekord für ein zweites Aprildrittel hielt übrigens 2018, welches allerdings
um 1,1 °C |
|
|
| |
|
kühler war. In die
Monatsmitte fiel demnach auch mit 25,1 °C das Maximum am 16. April. Es war
der |
|
|
|
| |
|
durchschnittlich eine
Sommertag, der im April auftreten soll. Die Jahre 2018 und 2024 mit je 4
Sommertagen |
|
|
| |
|
drücken hier die
Statistik aber nach oben. Zeitgleich war es der drittfrüheste Sommertag, den
es bei uns gab. |
|
|
| |
|
Einen Tag später, am 17.
April, sank das Thermometer nicht unter 10,1 °C, was das zweitmildeste
Aprilminimum |
|
| |
|
bedeutete. Ebenso
rangierten sich der 15. April (Minimum: 9,3 °C) und der 22. April (Minimum:
9,2 °C) unter den |
|
| |
|
mildesten Zehn ein. Den
Tiefstwert diesen Monat verzeichneten wir mit -3,2 °C am 7. April. Wir
zählten 4 |
|
|
| |
|
Frosttage (-2 Tage) und 4
kalte Tage (-6 Tage). |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Obwohl der April wahrlich
kein Niederschlagsgigant war und ist, sind trockene Aprilmonate in den
letzten Jahren |
|
|
| |
|
häufiger geworden. Mit
51,5 l/m² bei einem Minus von 61 % war es der niederschlagsärmste April seit
12 Jahren |
|
| |
|
(2013: 45 l/m²). Zuvor
blieb es 2009 (48 l/m²), 2007 (25 l/m²) und 2000 (25,5 l/m²) in unserer
Messreihe noch |
|
|
| |
|
trockener. Die Daten der
Hydrografischen Station in Faistenau zeigten weitere noch trockenere
Aprilmonate in |
|
|
| |
|
den Jahren 1968 (48,3
l/m²), 1952 (44,8 l/m²), 1939 (39,9 l/m²) und 1934 (41,6 l/m²). Heuer
verteilte sich der |
|
|
| |
|
Niederschlag auf die
Tiefstmarke von 5 Niederschlagstagen (-10 Tage). Den größten
Tagesniederschlag gab es |
|
| |
|
in Form von Schnee mit 18
l/m² gleich am 1. April. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bei diesem einen
Schneefalltag (-4 Tage) blieb es dann auch. Hier fielen alle 6 cm, die es im
April zu schneien |
|
|
| |
|
vermochte. Ein Minus von
78 %. Dennoch schaffte es der April das 16. Jahr in Folge in der
Schneestatistik |
|
|
| |
|
anzuschreiben. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am 1. April ereignete
sich demnach mit einer Höhe von 5 cm der einzige Schneedeckentag des Monats
(-8 |
|
|
| |
|
Tage). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Zahl der Regentage
konnte sich heuer selbst ein Fingeramputierter an einer Hand abzählen. Es gab
mit 4 |
|
|
| |
|
Regentagen (-8 Tage) die
niedrigste Anzahl in unserer Messreihe (bisher 5 Regentage im April 2007).
Wenig |
|
|
| |
|
überraschend fiel auch
die Monatsmenge mit 33,5 l/m² bei einer Abweichung von -62 % sehr bescheiden
aus. |
|
|
| |
|
2021 (28 l/m²), 2007 (25
l/m²) und 2000 (25,5 l/m²) regnete es im April noch weniger als heuer. Die
höchste |
|
|
| |
|
Tagessumme akkumulierte
sich mit 10,5 l/m² am 26 April. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dazwischen blieb eine
Menge Zeit für niederschlagsfreie Tage. Eine 16-tägige Periode ereignete sich
vom 2. Bis |
|
| |
|
zum 17. April. Es war die
zweitlängste Trockenphase, die sich überwiegend in einem April einstellte.
Weiters |
|
|
| |
|
vergingen vom 19. Bis zum
23. April 5 trockene Tage hintereinander. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Niederschlagsarmut war im
ersten Drittel des Jahres 2025 eine wachsende Größe. An unserer Station
in |
|
|
| |
|
Hintersee wurden bislang
330,5 l/m² gemessen. Damit fehlte seit Jänner genau die Hälfte des Solls.
Anhand der |
|
|
| |
|
Daten der
Hydrografischen Station in Faistenau war es der trockenste Jahresstart seit
1996. Ähnlich karg ging es |
|
| |
|
auch in den ersten vier
Monaten der Jahre 1991, 1934 und 1929 zu. Die Mitteltemperatur lag bis
inklusive April |
|
|
| |
|
um 2,4 °C über Normal und
hinter dem Rekordjahr 2024 auf Rang 2. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Monatsrangliste Niederschl. |
>> Klimatage |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Tagestemperaturen |
>> Winterstatistik |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Schnee |
>> Monatsvergleich Temp. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Do,
17.04.25 |
Hansdampf
bringt Sommertag und Föhnsturm |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Mitte der Karwoche
läutete nur im christlichen Sinne eine ruhige Zeit ein. Meteorologisch gab es
einiges |
|
|
| |
|
Berichtenswertes. Das
kräftige Italientief „Hans“ sorgte im Zusammenschluss mit kleinen Tiefs an
der |
|
|
| |
|
Alpennordseite für eine
Föhnlage, die es für Mitte April sehr warm und auch windig machte. So
erlebten wir in |
|
|
| |
|
Hintersee am gestrigen
16. April den drittfrühesten Sommertag in unserem Tal. Alles andere als
besinnlich verlief |
|
| |
|
der Gründonnerstag mit
Starken bis steifen Südföhnböen, warmen Tagestemperaturen und dem
zweitmildesten |
|
|
| |
|
Aprilminimum. Als wäre
dem nicht genug, endete außerdem die mit 16 trockenen Tagen am Stück
zweitlängste |
|
|
| |
|
niederschlagsfreie
Periode im April. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Wetterlage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ausgangsposition der
aktuellen Lage war die Verortung des Alpenraums zwischen einem Trog im Westen
und |
|
|
| |
|
einer Hochdruckzone im
Osten. Dabei reichte am Mittwoch der Trog, welcher mit mehreren Zentren über
den |
|
|
| |
|
Britischen Inseln
beheimatet war, über Frankreich bis in den westlichen Mittelmeerraum. Von
Mittwoch auf |
|
|
| |
|
Donnerstag vollzog sich
über dem Ligurischen Meer die Bildung eines Ablegertiefs namens „Hans“. In
der Folge |
|
|
| |
|
schob sich das
Ablegertief über den Golf von Genua am Donnerstag nach Oberitalien, wo es
anschließend zur |
|
|
| |
|
Adria und dem Balkan
übersetzte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Als Gegenspieler
fungierte eine breite Hochdruckzone, die von Skandinavien bis zum östlichen
Mittelmeerraum |
|
|
| |
|
langte. Der Hochkern fand
sich hierbei über Finnland. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Zwischen den beiden
Druckgebilden etablierte sich eine straffe Südströmung. Mit dieser gelangte
Saharastaub in |
|
| |
|
den Alpenraum. An der
Alpennordseite stellte sich eine markante Föhnlage ein. Diese wurde am
Mittwoch und |
|
|
| |
|
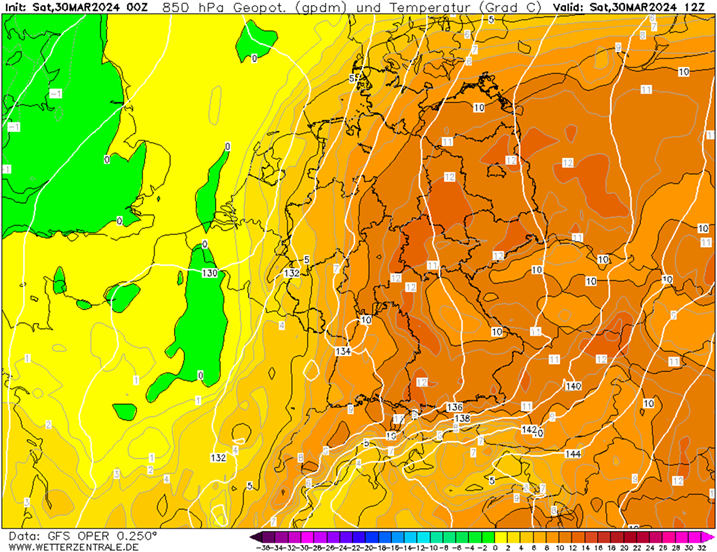
| vor
allem an Donnerstag durch föhnbedingte Leetiefs noch zusätzlich verstärkt.
Das erste Leetief am Mittwoch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
drehte seine Kreise über
Süddeutschland, ehe es nordwärts abzog. Schon am Donnerstag formte sich
das |
|
|
| |
|
zweite Leetief aus,
welches diesmal im nordöstlichen Alpenvorland Österreichs bzw. über
Tschechien |
|
|
| |
|
angesiedelt war. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Föhnsturm erlebte zu
Mittag und am Nachmittag des Donnerstages seinen Höhepunkt, da die
Sogwirkung |
|
|
| |
|
des Leetiefs das Pumpen
des Italientiefs unterstützte. Erst am Abend mit nordwärtigem Abzug des
Leetiefs und |
|
|
| |
|
gleichzeitigem
Näherkommen des Ablegertiefs südlich des Alpenhauptkamms brach der Föhn
zusammen. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Bild: Großwetterlage in
Europa zu Donnerstagmitternacht |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Alpen als markante
Wetterscheide |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Das Wettergeschehen
stellte sich auf den beiden Seiten der Alpen äußerst unterschiedlich dar.
Während es im |
|
|
| |
|
Süden zu starken
Niederschlägen kam, blies an der Nordseite der Föhnsturm und es gab
frühsommerliche |
|
|
| |
|
Temperaturen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der wärmere Tag war der
Mittwoch. Trotz Saharastaubeintrages und daraus immer wieder
durchziehender |
|
|
| |
|
Schleierbewölkung,
überwog doch der Sonnenschein. Am Donnerstag konnte der Föhn die Wolken nicht
mehr |
|
|
| |
|
gut aufreißen und es
wurde nicht mehr ganz so warm wie am Vortag. Dafür lagen die
Windgeschwindigkeiten |
|
|
| |
|
höher. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am wärmsten wurde es
dabei im Alpenvorland von Ober- und Niederösterreich. Am Mittwoch kletterten
die |
|
|
| |
|
Thermometer in St.
Pölten auf 28,3 °C, in Melk (beide Niederösterreich) sowie in Kremsmünster
(Oberösterreich) |
|
| |
|
auf jeweils 27,6 °C.
Dahinter folgten Krems mit 27,4 °C und Wieselburg mit 27,2 °C (Beide
Niederösterreich). |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Spitzenreiter am
Donnerstag war Melk mit 27,8 °C vor St. Pölten mit 26,9 °C und Amstetten
(Niederösterreich) |
|
|
| |
|
sowie Linz/Hörsching
(Oberösterreich) mit je 26,6 °C. Reichersberg (Oberösterreich) und Wieselburg
kamen auf |
|
| |
|
26,5 °C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Abseits der später noch
erwähnten regionalen Stationen war am Donnerstag der Föhn in Hochfilzen
(Tirol) mit 96 |
|
| |
|
km/h am kräftigsten
unterwegs. Schwere Sturmböen gab es ebenso in St. Ägyd (Niederösterreich) mit
91 km/h |
|
|
| |
|
und Mariazell
(Steiermark) sowie Enns (Oberösterreich) mit je 89 km/h. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Schadensträchtige
Regenfälle, die zu Murenabgängen und Überschwemmungen führten, gab es durch
Tief |
|
|
| |
|
„Hans“ südlich der Alpen
in einem Bogen von der Schweiz, Nordwestitalien bis nach Korsika. Hier
fielen |
|
|
| |
|
innerhalb von 2 Tagen
teils 200, 300 l/m² Niederschlag. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Erster Sommertag in
Salzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am Mittwoch hielt sich
der Föhn in Salzburg noch etwas zurück. Meist traten Spitzenböen um 40, 50
km/h in den |
|
|
| |
|
Talschaften auf.
Stürmisch pfiff der Südföhn schon im Lammertal, wo Böen bis 62 km/h in
Abtenau und 70 km/h |
|
|
| |
|
in Golling gemessen
wurden. Eine Sturmböe, die schnellste ganz Österreichs, fegte mit 77 km/h
durch Zell am |
|
|
| |
|
See. Schwere Sturmböen
gab es auf den Bergen. Auf der Rudolfshütte (2.304 m) wurden 91 km/h, auf
der |
|
|
| |
|
Schmittenhöhe (1.973 m)
92 km/h und am Sonnblick 95 km/h gemessen. Am benachbarten Feuerkogel bei
Bad |
|
|
| |
|
Ischl waren es 84 km/h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am Feuerkogel erreichten
die Temperaturen auch hohe 16,5 °C. Dadurch wurde es im inneren
Salzkammergut |
|
|
| |
|
sommerlich warm. In Bad
Ischl stieg das Thermometer auf 26,3 °C, in Bad Goisern auf 25,7 °C. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Im Bundesland Salzburg
war es mit 25,8 °C in der Landeshauptstadt am wärmsten. Knapp dahinter
Mattsee mit |
|
|
| |
|
25,7 °C. Am Kolomansberg
(1.114 m) war es für die Jahreszeit mit 20,9 °C ebenso ausgesprochen warm.
Den |
|
|
| |
|
gleichen Höchstwert
erzielte das stürmische Zell am See, auf der Schmittenhöhe hatte es 10,4 °C.
Fast für einen |
|
| |
|
Sommertag reichte es in
Lofer mit 24,3 °C, wo es auf der Loferer Alm (1.618 m) bis 14,2 °C hinauf
ging. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Höchstwerte in Salzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Abtenau |
|
23,9 °C |
16.4. |
|
Rudolfshütte |
5,3 °C |
16.4. |
|
|
| |
|
Bad Hofgastein |
20,3 °C |
16.4. |
|
Salzburg/Freisaal |
25,8 °C |
16.4. |
|
|
| |
|
Bischofshofen |
22,9 °C |
16.4. |
|
Schmittenhöhe |
11,1 °C |
17.4. |
|
|
| |
|
Kolomanserg |
20,9 °C |
16.4. |
|
Sonnblick |
|
*-1,1 °C |
16.4. |
|
|
| |
|
Krimml |
|
21,1 °C |
16.4. |
|
St. Wolfgang |
24,9 °C |
16.4. |
|
|
| |
|
Lofer |
|
24,3 °C |
16.4. |
|
St. Johann |
|
23,4 °C |
16.4. |
|
|
| |
|
Loferer Alm |
|
14,2 °C |
16.4. |
|
st. Michael |
|
17,7 °C |
16.4. |
|
|
| |
|
Mariapfarr |
|
17,2 °C |
16.4. |
|
St. Veit |
|
22,7 °C |
16.4. |
|
|
| |
|
Mattsee |
|
25,7 °C |
164. |
|
Tamsweg |
|
18,9 °C |
16.4. |
|
|
| |
|
Rauris |
|
20,8 °C |
16.4. |
|
Zell am See |
20,9 °C |
16.4. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Föhnsturm am
Gründonnerstag |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dichtere Wolkenfelder und
kräftiger Wind verhinderten am Gründonnerstag einen neuerlichen
Sommertag. |
|
|
| |
|
Dennoch war es für Mitte
April wiederum recht warm. Spitzenreiter war Mattsee mit 24,6 °C vor |
|
|
|
| |
|
Salzburg/Freisaal mit 24
°C. Knapp geschlagen mussten sich Bad Ischl mit 23,5 °C und St. Wolfgang mit
23,4 °C |
|
| |
|
aus dem Salzkammergut
sowie Lofer mit 23,3 °C geben. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dafür kam der Südföhn nun
flächiger mit heftigen Böen auf. Einen orkanartigen Föhn erlebte Zell am See
mit |
|
|
| |
|
107 km/h. Schwere
Sturmböen gab es in Golling mit 96 km/h und im benachbarten Mondsee mit 92
km/h. |
|
|
| |
|
Föhnsturm verzeichneten
mit Bad Goisern (80 km/h) und St. Wolfgang (79 km/h) weitere Orte im |
|
|
|
| |
|
Salzkammergut. Hinzu
gesellten sich noch Abtenau und Bad Gastein mit 77 km/h. Sonst lagen die
Spitzenböen |
|
|
| |
|
meist zwischen 50 und 70
km/h, Ausnahme blieb der bereits regnerische Lungau. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Auf den Bergen gab es am
Sonnblick Föhnorkan mit Böen bis 134 km/h. Auf der Schmittenhöhe waren es
113 |
|
|
| |
|
km/h, auf der
Rudolfshütte 107 km/h und auf der Loferer Alm 88 km/h. In den nördlichen
Kalkalpen war der Wind |
|
|
| |
|
auf den Gipfeln nicht
ganz so stark und erreichte am Feuerkogel 103 km/h, am Kolomansberg und
am |
|
|
| |
|
Zwölferhorn 75 km/h. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Drittfrühester Sommertag
in Hintersee |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Hintersee dämpften am
Mittwoch zwar auch Saharastaub und daraus entstandene Schleierwolken etwas
den |
|
|
| |
|
Sonnenschein, dieser war
dennoch kräftig genug, um mit Unterstützung des teils lebhaft aufkommenden
Föhns |
|
|
| |
|
aus Süd bis Südost die
Temperatur nach oben zu treiben. In den Mittagsstunden stieg das Thermometer
bei |
|
|
| |
|
unserer Station auf 25,1
°C an. Das bedeutete den drittfrühesten meteorologischen Sommertag im Tal
von |
|
|
| |
|
Faistenau und Hintersee
seit den 1960er Jahren. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Eine neue Bestmarke wurde
hier erst vor einem Jahr mit 25,5 °C am 7. April 2024 aufgestellt. Letztes
Jahr gab |
|
|
| |
|
es gleich drei Sommertage
hintereinander in der ersten Aprildekade. Zuvor ereignete sich der
früheste |
|
|
| |
|
Sommertag mit 26 °C am
13. April 2007. Dahinter folgen der 20. April 2018 mit 27,5 °C und der 22.
April 2000 |
|
|
| |
|
mit 26,2 °C. In den
Jahrzehnten davor kamen Sommertage im April mit Ausnahme des Jahres 1969
nicht vor. |
|
|
| |
|
Laut den Daten der
Hydrografischen Station in Faistenau ereignete sich der erste Sommertag in
der |
|
|
|
| |
|
Vergleichsperiode
1961-90 durchschnittlich am 31. Mai. In der Messreihe der Wetterstation
Hintersee (seit 2002) |
|
| |
|
hat sich das
durchschnittlich erste Auftreten des Premierensommertages schon auf den 10.
Mai vorverlegt. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sehr milde Tiefstwerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Durch den Föhn blieben
die Tagesminima ebenso für die Jahreszeit ausgesprochen mild. Schon am
Dienstag |
|
|
| |
|
fiel das Quecksilber
nicht unter 9,3 °C, was den fünftmildesten Tiefstwert eines Apriltages
bedeutete. Noch |
|
|
| |
|
milder blieb es am
Gründonnerstag, der erst am Abend mit Ausklingen des Föhns eine gewisse
Abkühlung fand. |
|
| |
|
Trotzdem sank das
Thermometer nicht unter 10,1 °C. Es war das zweitmildeste Minimum im April.
Den Rekord |
|
|
| |
|
gab es erst vor einem
Jahr, am 8. April 2024 mit 10,4 °C. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Früheste Sommertage in
Hintersee und Faistenau |
Höchste Aprilminima in
Hintersee |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
*7. April 2024 |
25,5 °C |
|
1 |
08.04.2024 |
10,4 °C |
|
|
| |
|
2 |
*13. April 2007 |
26,0 °C |
|
2 |
17.04.2025 |
10,1 °C |
|
|
| |
|
3 |
*16. April 2025 |
25,1 °C |
|
3 |
15.04.2024 |
10,0 °C |
|
|
| |
|
4 |
*20. April 2018 |
27,5 °C |
|
4 |
25.04.2020 |
9,4 °C |
|
|
| |
|
5 |
*22. April 2000 |
26,3 °C |
|
5 |
06.04.2024 |
9,3 °C |
|
|
| |
|
6 |
*24. April 2019 |
25,1 °C |
|
|
15.04.2025 |
9,3 °C |
|
|
| |
|
7 |
26. April 1969 |
25,8 °C |
|
7 |
23.04.2018 |
9,1 °c |
|
|
| |
|
|
*26. April 2012 |
26,0 °C |
|
8 |
14.04.2024 |
8,9 °C |
|
|
| |
|
|
*26. April 2013 |
26,3 °C |
|
9 |
30.04.2010 |
8,8 °C |
|
|
| |
|
10 |
*30. April 2003 |
27,0 °C |
|
|
24.04.2018 |
8,8 °C |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2020 |
8,8 °C |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
16 Tage trocken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Neben dem ersten
Sommertag hatte sich bei uns in Hintersee auch eine markante Trockenperiode
eingestellt. |
|
|
| |
|
Diese bescherte uns vom
2. Bis zum 17. April eine 16-tägige Phase ohne Niederschlag. Es war gemeinsam
mit |
|
|
| |
|
den 16
niederschlagsfreien Tagen vom 16. April bis zum 1. Mai 2011 die zweitlängste
Trockenperiode, die zur |
|
|
| |
|
Gänze oder zum Großteil
in einem April auftrat. Die längste Serie an niederschlagsfreien Tagen am
Stück |
|
|
| |
|
ereignete sich über 17
Tage vom 31. März bis zum 16. April 2009. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Niederschlagsfreie
Perioden im April in Hintersee |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
31.03.2009 |
######## |
|
17 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
16.04.2011 |
######## |
|
16 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
02.04.2025 |
######## |
|
16 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
4 |
02.04.2002 |
######## |
|
12 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
01.04.2020 |
######## |
|
12 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
6 |
27.03.2016 |
######## |
|
10 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
16.04.2019 |
######## |
|
10 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
8 |
09.04.2007 |
######## |
|
9 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
07.04.2018 |
######## |
|
9 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
10 |
28.03.2004 |
######## |
|
8 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
25.04.2007 |
######## |
|
8 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
24.04.2013 |
######## |
|
8 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
28.03.2019 |
######## |
|
8 Tage |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Vereinzelte
Feuerwehreinsätze durch Föhnsturm |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Salzburg mussten in
einigen Orten die Feuerwehren zu kleineren Einsätzen in Folge des Südföhns
ausrücken. |
|
|
| |
|
Zum Großteil waren
umgefallene Bäume der Ausrückungsgrund. In Eugendorf traf ein baum ein
geparktes Auto. |
|
|
| |
|
In Bischofshofen
versperrten Bäume die Hochkönigbundesstraße und in Hallein wurden Teile eines
Daches auf |
|
|
| |
|
die
Salzachtalbundesstraße geweht. Weitere Ausrückungen gab es in der
Landeshauptstadt, in Neumarkt und in |
|
| |
|
Zell am See. Am
Donnerstagabend kam es in Henndorf außerdem zu einem kleinen Waldbrand. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle:
www.austrowetter.at, wetter.orf.at, www.salzburg24.at, www.12erhorn.at |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Tagestemperaturen |
>> Schönwetterperioden |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Di,
01.04.25 |
Rückblick
März: Wärme und Schneearmut im Wiederholungsmodus |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 163 l/m² Niederschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 12,5 cm Neuschnee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 4,7 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
*+ frühester Zwanziger |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der März 2025 war lange
Zeit ein sehr sonniger Strahlemann, der mit Trockenheit und Wärmeeskapaden
auf |
|
|
| |
|
sich aufmerksam machte.
In eine für Anfang März unbekannten Wärmewelle gab es den ersten Zwanziger
gleich |
|
|
| |
|
um 2 Wochen früher als
bisher. Dieser Monat wurde zum drittwärmsten März der Messreihe. In der
letzten |
|
|
| |
|
Woche linderten
zahlreiche Regen-, Graupel und auch Schneeschauer das aufgekommene
Winterdefizit beim |
|
|
| |
|
Niederschlag. Keine
Mildtätigkeit erfuhr die Schneebilanz. Wir erlebten einen weiteren sehr
schneearmen März, |
|
|
| |
|
was seit 15 Jahren sehr
häufig geworden ist. Zur Zeit davor brach das Schneesoll im März um enorme
zwei |
|
|
| |
|
Drittel ein. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die erste Märzdekade
verlief im Alpenraum unter Dauerhochdruck. Dabei breitete sich gleich zu
Monatsbeginn |
|
|
| |
|
vom Nordostatlantik her
eine Hochdruckzone über die Britischen Inseln bis zum Balkan aus, in der sich
in |
|
|
| |
|
weiterer Folge ein
separates Hoch südöstlich von uns etablierte. Im Zusammenspiel mit der
Vorderseite eines |
|
|
| |
|
Biscayatiefs gelangte
sehr milde Luft samt Saharastaub aus Südwest herbei. Eine
außergewöhnliche |
|
|
| |
|
Wärmewelle für Anfang
März setzte ein. Mit Schwenk in das zweite Monatsdrittel bekamen der
Tiefdruck im |
|
|
| |
|
Raum der Iberischen
Halbinsel und des Baltikums etwas mehr Zugriff und mit leichter
Wechselhaftigkeit gab es |
|
|
| |
|
die ersten dünnen
Niederschläge des Monats. Während dessen hatte sich das einstige Wärmehoch
ostwärts |
|
|
| |
|
zurückgezogen. Es wurde
von einem neuen Hoch im Nordwesten des Kontinents abgelöst. An dessen |
|
|
| |
|
Vorderseite strömte kalte
Luft ins östliche Mitteleuropa und traf hier auf feuchte Luft, welche
durch |
|
|
|
| |
|
Tiefdruckaktivität über
dem zentralen Mittelmeerraum herantransportiert wurde. Nach der
Monatsmitte |
|
|
| |
|
schwenkte das Hoch
südostwärts durch und brachte den Alpenraum alsbald erneut auf die sehr milde
Front |
|
|
| |
|
eines Ostatlantiktroges.
Zum zweiten Dekadenwechsel hin wurde es damit nach einem kurzen
Frosteinschub |
|
|
| |
|
rasch wieder sehr mild
und mit einer abermaligen Portion an Saharastaub verliefen die Nächte zudem
für März |
|
|
| |
|
lau. Im letzten
Märzdrittel verließ zuerst der Einfluss eines Hochs über Nordosteuropa den
Alpenraum, ehe er |
|
|
| |
|
von Westen her in einen
Tiefdrucksumpf mit mehreren kleinen Druckminima geriet. Wirbel über dem
Ärmelkanal, |
|
| |
|
der Ostsee und dem
zentralen Mittelmeerraum gestalteten diese Phase unbeständig mit zahlreichen
Schauern. |
|
|
| |
|
Zwischenhochdruck von den
Britischen Inseln unterbrach die wechselhafte Witterung nur kurz. Zum
Monatsende |
|
|
| |
|
steuerten erst ein
Adriatief und dann ein Nordseetief Regen und Schnee herbei. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der größer werdende
Tiefdruckeinfluss bremste den Überschuss an Sonnenstunden, der diesen März
in |
|
|
| |
|
Österreich bundesweit +11
% betrug. Dabei gab es von Oberösterreich bis ins westliche Niederösterreich
mit |
|
|
| |
|
Zugewinnen bis zur Hälfte
die höchste Sonnenscheindauer. Die restliche Osthälfte war mit Überschüssen
bis zu |
|
|
| |
|
einem Viertel ebenso noch
gut versorgt. Im Westen schien die Sonne ausgeglichen lang, einzig in
Osttirol und |
|
|
| |
|
Oberkärnten gab es
Einbußen bis zu einem Viertel. Sonnigster Ort war der Brunnenkogel (Tirol)
mit 210 |
|
|
| |
|
Stunden. Es gab zwar im
März einen Wechsel aus warmen und kühleren Phasen, jedoch überwogen die |
|
|
| |
|
Wärmeeinschübe. Mit einer
Abweichung von +1,7 °C zur aktuellen Referenzperiode 1991-2020 im
Tiefland |
|
|
| |
|
verpasste der heurige
März die ersten Zehn der Messgeschichte nur knapp. Auf den Bergen war es um
2,3 °C |
|
|
| |
|
wärmer als im Mittel. Im
Vergleich zur Normalperiode 1961-90 lagen die Abweichungen mit +3,0 bzw. +3,6
°C |
|
|
| |
|
schon deutlich höher. Die
Niederschlagsbilanz fiel für Österreich zwiespältig aus. Die bisher so
trockenen |
|
|
| |
|
Landesteile bekamen
endlich Regen, dafür blieb es im Westen mit einem bis zwei Drittel
weniger |
|
|
|
| |
|
niederschlagsarm.
Ausgeglichen ging der März von Oberösterreich bis Osttirol ins Land. Von
Kärnten bis |
|
|
| |
|
Niederösterreich gab es
mit Zugewinnen bis zu drei Viertel endlich brauchbare Mengen an Nässe seit
dem |
|
|
| |
|
Hochwasserereignis im
September 2024. Regional war der März sogar um das Doppelte oder Dreifache
zu |
|
|
| |
|
feucht. Bundesweit betrug
die Abweichung +37 %. Es war der nasseste März seit 2009.
Niederschlagsreichster |
|
|
| |
|
Ort war der Loiblpass
(Kärnten) mit 373 l/m². |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Niederschlagsbilanz
erwies sich in Hintersee lange Zeit als sehr dürftig. Erst die rege
Schauertätigkeit im |
|
|
| |
|
letzten Monatsdrittel
verhalfen dem heurigen März mit einer Summe von 163 l/m² bei +10 % zu
einer |
|
|
|
| |
|
ausgeglichenen
Niederschlagsmenge. Der März 2025 war damit fast genau gleich nass wie seine
Vorgänger aus |
|
| |
|
2010 (162,5 l/m²) und
2015 (162 l/m²). Der akkumulierte Niederschlag verteilte sich auf exakt im
Schnitt liegende |
|
| |
|
15 Niederschlagstage.
Nassester Tag war mit 41 l/m² der 31. März. Dagegen blieb es vom 1. bis zum
9. März 9 |
|
|
| |
|
Tage hintereinander
trocken und weitere 5 Tage vom 18. bis zum 22. März. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Pünktlich am Abend des
Welltages der Meteorologie, am 23. März, erfolgte der Auftakt in die
Gewittersaison mit |
|
| |
|
dem Streifen der einzigen
Zelle des Monats, welche mit leichten Regen verbunden war. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
An Regen summierten sich
im März 126,5 l/m², was bei -4 % Abweichung einen Platz im Mittelfeld
bedeutete. Es |
|
| |
|
regnete im diesjährigen
März etwas weniger als in den beiden Vorjahren. Regenreichster Tag war mit 25
l/m² der |
|
| |
|
31. März. Es gab 13
Regentage (+3 Tage). |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ein leider fast schon
gewohntes Trauerspiel lieferte der März in Sachen Neuschnee. Lediglich 12,5
cm schneite |
|
|
| |
|
es diesen Monat, um 87 %
unter dem Soll. Es gab 5 Schneefalltage (-4 Tage), wovon der 17. März mit 6
cm |
|
|
| |
|
noch der schneereichste
war. Der März 2025 zählte zu den 7 schneeärmsten unserer Messreihe (seit
1988. Es |
|
|
| |
|
war in den letzten 15
Jahren der 14. teils extrem unterdurchschnittliche März. Einzig 2021 (225,5
cm) konnte |
|
|
| |
|
dieser noch gegen den
Trend schwimmen. Die durchschnittliche Neuschneesumme im März ist von 130 cm
im |
|
|
| |
|
Zeitraum 1988-2010 auf 45
cm im Zeitraum 2011-2025 zurückgegangen. Ein großer Absturz von 65 %. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Prolongiert wurde der
Negativrekord an Schneedeckentagen. Wie im Vorjahr gab es nur an 2 Tagen (17.
und 31. |
|
| |
|
März) an unserer Station
eine geschlossene Schneedecke mit einer Schneehöhe von jeweils 3 cm. In
unserer |
|
|
| |
|
Messreihe waren zuvor 10
Schneedeckentage aus dem März 2020 das Minimum. Durchschnittlich sollte es
im |
|
|
| |
|
März noch an 25 Tagen
eine geschlossene Schneedecke an unserer Station geben. Die Daten der |
|
|
|
| |
|
Hydrografischen Station
in Faistenau zeigten für die letzten 6 Jahrzehnte nur im März 1972 einen
ähnlichen |
|
|
| |
|
Tiefststand (2
Schneedeckentage). Allerdings sind die Messdaten dort mehr mit den
Verhältnissen im Ortsteil |
|
|
| |
|
Oberasch vergleichbar und
nur bedingt mit jenen am Standort der Wetterstation Hintersee. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Abstinenz einer
kühlenden Schneedecke trieb es die Temperaturen ein zweites Jahr in Folge
stark nach oben. |
|
| |
|
im ersten und dritten
Monatsdrittel gab es sehr große bis große positive Abweichungen, das
Mitteldrittel lag nur |
|
|
| |
|
gering über Schnitt.
Daraus errechnete sich eine Monatsmitteltemperatur von 4,7 °C bei einer
Abweichung von |
|
|
| |
|
+2,7 °C. Hinter dem
wahnsinnig warmen März 2024 und dem alten Rekord aus 2017 (Mittel: 4,8 °C)
reihte sich |
|
|
| |
|
der heurige März auf
Platz 3 ein. Mit dem viertplatzierten März 2014 (Mittel: 4,6 °C) gibt es nun
ein Quartett, das |
|
|
| |
|
den Rest deutlich
überragt. Die höchste Temperatur verzeichneten wir mit 21,3 °C am 6. März,
dem |
|
|
|
| |
|
fünftwärmsten Märztag
unserer Messreihe. Noch nie war es zuvor so früh im Jahr so warm. Der 9. März
schaffte |
|
|
| |
|
es mit 20,5 °C als 9.
ebenso noch in die ersten Zehn. Den Tiefstwert erzielten wir mit -6,5 °C am
18. März. Vier |
|
|
| |
|
Tage später sank das
Thermometer nicht unter 5,4 °C, was das fünftmildeste Märzminimum der
Messreihe war. |
|
|
| |
|
Die Tiefstwerte von 5,1
°C am 25. und 26. März errangen ebenfalls Platzierungen in den Top 10. Die
Zahl der |
|
|
| |
|
Eistage blieb wieder auf
0 (-2 Tage). An Frosttagen ereigneten sich mit 9 Tagen nur die Hälfte und
damit hinter |
|
|
| |
|
2024 (3 Frosttage) und
2017 (6 Frosttage) die drittwenigsten. Die Summe der kalten Tage reihte sich
mit 11 (-8 |
|
|
| |
|
Tage) ebenso auf dem
drittletzten Platz hinter 2014 (9 kalte Tage) und 2024 (10 kalte Tage) ein. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Monatsrangliste Niederschl. |
>> Klimatage |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Tagestemperaturen |
>> Winterstatistik |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Schnee |
>> Monatsvergleich Temp. |
>> Gewitterstatistik |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
So,
09.03.25 |
Föhnige
Wärmewelle bringt frühsten 20er |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Drehte schon der
letztjährige März mit zahlreichen 20ern zur Osterzeit völlig irrsinnig am
Erwärmungsradl, so |
|
|
| |
|
wollte ihm scheinbar der
März 2025 mit seiner eigenen Bestmarke nicht nachstehen. Von Mittwoch bis
Sonntag |
|
|
| |
|
präsentierte sich der
März in einer ungemein frühen und kräftigen Wärmewelle, welche mit leichten
Föhneffekten |
|
|
| |
|
den frühsten 20er gleich
um zwei Wochen nach vorne verschob. Zudem blieb es zuvor noch nie derart
zeitig im |
|
|
| |
|
Jahr im Tal von Faistenau
und Hintersee über so viele Tage so warm. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Wetterlage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Den Ausgangspunkt für die
Wärmewelle markierte am Mittwoch ein Hochdruckgebiet mit Kern über dem |
|
|
| |
|
östlichen Mitteleuropa,
in dessen Einfluss der Alpenraum zu liegen kam. Mit einer leichten südlichen
bis |
|
|
| |
|
südöstlichen Strömung
wurde Warmluft aus dem Mittelmeerraum advehiert. Gestützt wurde das Hoch
„Ingeborg“ |
|
|
| |
|
von einem Tiefkomplex
westlich der Iberischen Halbinsel. Die Frontalzone hatte sich weit
nördlich |
|
|
|
| |
|
zurückgezogen und verlief
von Grönland nach Skandinavien. |
|
|
|
|
|
|
| |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Im weiteren Verlauf
wanderte das Hoch mit seinem Zentrum an den Folgetagen über Südosteuropa
hinweg zum |
|
|
| |
|
Schwarzen Meer, wodurch
sich seine schwindende Dominanz zwar am Barometer abzeichnete, jedoch sich
am |
|
|
| |
|
Wettergeschehen nichts
änderte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Gegenteilig wurde die
süd- bis südwestliche Höhenströmung am Wochenende in Folge einer
ostatlantischen |
|
|
| |
|
Austrogung durch ein sich
über der Biscaya ausformendes Tief abermals gestärkt. Dadurch blieb die
Zufuhr der |
|
|
| |
|
subtropischen Luftmasse
aufrecht, die in Verbindung mit einer geringen Konzentration an Saharastaub
aus |
|
|
| |
|
Nordafrika herbeigeführt
wurde. Die angezapfte Luftmasse war einerseits sehr trocken und zwischen 8
und 12 |
|
|
| |
|
Grad in rund 1.500 m
ungemein mild für die Jahreszeit. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
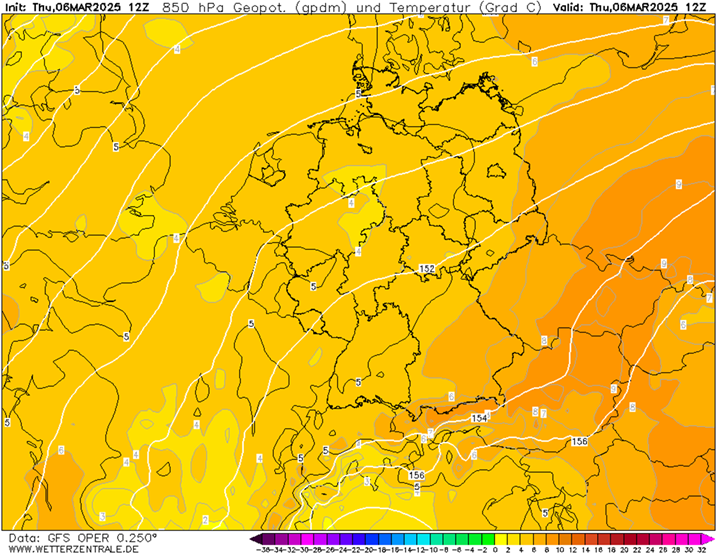
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Bild. Großwetterlage in
Europa zu Mittwochmitternacht |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Bild. Temperatur der
Luftmasse in 1.500 m Höhe in Mitteleuropa zu Donnerstagmittag |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Vollfrühling oder ein
kleiner Frühsommerhauch |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Für die Jahreszeit
ungewöhnlich mild oder eigentlich schon warm wurde es überall in Österreich.
AM höchsten |
|
|
| |
|
stiegen die Temperaturen
allerdings im östlichen Alpenvorland. Mit einem Maximum von 24,1 °C in Bad
Vöslau |
|
|
| |
|
(Niederösterreich) waren
wir am Donnerstag nicht mehr weit von einem meteorologischen Sommertag
entfernt. |
|
|
| |
|
Weyer (Oberösterreich)
mit 23,7 °C und Berndorf (Niederösterreich) mit 23,6 °C schafften es ebenso
auf das gut |
|
| |
|
gewärmte Stockerl. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die zweithöchsten
Tageswerte des Ereignisses gab es dann am Sonntag. Die drei wärmsten Orte in
Österreich |
|
|
| |
|
kamen diesmal alle aus
Niederösterreich. Krems und St. Pölten siegten ex aequo mit 23,0 °C vor
Wieselburg mit |
|
| |
|
22,8 °C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Höchstwerte in Österreich |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
6. März |
|
|
|
9. März |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bad Vöslau |
|
24,1 °C |
|
Krems |
|
23,0 °C |
|
|
|
|
| |
|
Weyer |
|
23,7 °C |
|
St. Pölten |
|
23,0 °C |
|
|
|
|
| |
|
Berndorf |
|
23,6 °C |
|
Wieselburg |
22,8 °C |
|
|
|
|
| |
|
Pottschach |
|
23,2 °C |
|
Waidhofen/Ybbs |
22,7 °C |
|
|
|
|
| |
|
Gumpoldskirchen |
23,0 °C |
|
Amstetten |
|
22,4 °C |
|
|
|
|
| |
|
Wiener Neustadt |
23,0 °C |
|
Melk |
|
22,4 °C |
|
|
|
|
| |
|
Klausen-Leopoldsdorf |
23,0 °C |
|
Weyer |
|
22,4 °C |
|
|
|
|
| |
|
Eisenstadt |
|
22,0 °C |
|
Oberndorf/Melk |
22,4 °C |
|
|
|
|
| |
|
Wien/ Innere Stadt |
21,9 °C |
|
Linz-Stadt |
|
22,1 °C |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Frühlingshaft warmes
Salzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Auch in Salzburg
kletterten in vielen Orten die Thermometer zwischen Mittwoch und Sonntag weit
nach oben. |
|
|
| |
|
Viele offizielle
Stationen erzielten ihren Höchstwert bereits am Donnerstag, hier gab es vier
20er. AM wärmsten |
|
|
| |
|
war es mit 20,8 °C in
Lofer vor Abtenau mit 20,7 °C, Bischofshofen mit 20,4 und St. Veit mit 20,3
°C. Alle |
|
|
| |
|
anderen Stationen
bewegten sich zwischen den 15,1 °C in St. Michael und den 18,9 °C in St.
Johann. Noch |
|
|
| |
|
höher lagen die Maxima im
benachbarten Salzkammergut, wo Bad Goisern 21,2 °C und Bad Ischl 21,5 °C |
|
|
| |
|
erreichten. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Am Sonntag gab es
wiederum an 4 Standorten Temperaturen über 20 Grad. Im Bundesland Salzburg
war es |
|
|
| |
|
aufgrund der 21,8 °C in
der Stadt Salzburg und den 21,2 °C in Lofer der nach Spitzenwerten wärmste
Tag des |
|
|
| |
|
Ereignisses.
Bischofshofen mit 20,1 °C und Abtenau mit 20 °C komplettierten das
Führungsquartett. Der Rest |
|
|
| |
|
landete zwischen den
13,9 °C in St. Michael und den 19,6 °C in St. Veit. Die Nachbarn in Bad Ischl
(21,4 °C) und |
|
| |
|
Bad Goisern (20,9 °C)
waren ebenso wieder sehr gut dabei. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Keine Spur von Spätwinter
war auch auf den Bergen zu entdecken. Am Kolomansberg (1.114 m) stieg
das |
|
|
| |
|
Quecksilber auf 15,3 °C.
Am Feuerkogel (Oberösterreich, 1.618 m) ging es auf sehr milde 11,5 °C und
auf der |
|
|
| |
|
Loferer Alm (1.623 m) auf
11,1 °C. Einzig am Sonnblick (3.105 m) hielt sich mit maximal -5,1 °C
Dauerfrost. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Höchstwerte in Salzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Abtenau |
|
20,7 °C |
6.3. |
|
Rudolfshütte |
3,2 °C |
6.3. |
|
|
| |
|
Bad Hofgastein |
18,7 °C |
6.3. |
|
Salzburg/Fr. |
21,8 °C |
9.3. |
|
|
| |
|
Bischofshofen |
20,4 °C |
6.3. |
|
Schmittenhöhe |
8,6 °C |
6.+9.3. |
|
|
| |
|
Kolomansberg |
15,3 °C |
9.3. |
|
Sonnblick |
|
-5,1 °C |
6.3. |
|
|
| |
|
Krimml |
|
16,7 °C |
6.3. |
|
St. Johann |
|
18,9 °C |
6.3. |
|
|
| |
|
Lofer |
|
21,2 °C |
9.3. |
|
St. Michael |
|
15,1 °C |
6.3. |
|
|
| |
|
Loferer Alm |
|
11,1 °C |
9.3. |
|
St. Wolfgang |
21,3 °C |
9.3. |
|
|
| |
|
Mariapfarr |
|
15,1 °C |
6.3. |
|
St. Veit |
|
20,3 °C |
6.3. |
|
|
| |
|
Mattsee |
|
19,0 °C |
9.3. |
|
Tamsweg |
|
16,4 °C |
6.3. |
|
|
| |
|
Rauris |
|
17,3 °C |
6.3. |
|
Zell am See |
19,1 °C |
9.3. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Außergewöhnlicher
Wärmeeinbruch in Hintersee |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Schneedecke hatte
sich bereits bis auf wenige kleine Reste an schattigen Fleckerln schon Ende
Februar zur |
|
| |
|
Gänze aus dem Tal
zurückgezogen und so konnte die mittlerweile kräftige Sonneneinstrahlung in
Verbindung mit |
|
| |
|
sanften Föhneffekten die
Temperaturen so richtig über den jahreszeitlichen Plafond hinaus treiben. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Von Mittwoch bis Sonntag
stellte sich in Hintersee eine ungemein frühe Wärmewelle ein, die noch dazu
für |
|
|
| |
|
Anfang März noch nie da
gewesene Höchstwerte brachte. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Nach ohnehin schon sehr
milden 16,1 °C am 5. März ging es am Donnerstag mit leichten Südostföhn bis
auf |
|
|
| |
|
unglaubliche 21,3 °C um
13:24 Uhr hinauf. Durch die Nordwest-Südost-Ausrichtung des Tales wirkt
Föhnwind |
|
|
| |
|
genau aus dieser Richtung
in Hintersee besonders aufheizend und diesmal passten die Bedingungen
perfekt. |
|
|
| |
|
Bemerkenswert war zudem
der Tagesgang von 20 Grad, weil es in der Nacht noch auf 1,4 °C abzukühlen
vermochte. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Freitag und Samstag
waren sich mit Maxima von 17,3 und 17,1 °C relativ einig, ehe sich am 9. März
mit erneuter |
|
| |
|
leichter
Föhnunterstützung der zweite Höhepunkt einstellte. Um 14:24 Uhr erreichte das
Thermometer mit 20,5 |
|
|
| |
|
°C abermals die
20-Grad-Marke. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
AN allen Tagen nutzte die
Sonne ihr Potential voll aus und schien den ganzen Tag über, meist von einem
klar- |
|
|
| |
|
blauen Himmel. Erst im
Laufe des Samstags wurde der Eindruck durch den herangewehten Saharastaub
etwas |
|
|
| |
|
diesig. Abseits davon war
die Luftmasse recht trocken und so konnte es dennoch eine verhältnismäßig
gute |
|
|
| |
|
Nachtauskühlung geben und
die Minima blieben nur dünn im positiven Bereich. AM Boden breitete sich Reif
aus. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
März-Top-10 mit 20ern
vervollständigt |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die erwähnten 21,3 °C vom
6. März waren gleich auf mit dem 27. März 2024 der fünftwärmste Märztag
in |
|
|
| |
|
unserer Messreihe. Die
20,5 °C vom 9. März teilten sich den 8. Rang mit dem 31. März des Vorjahres.
Somit |
|
|
| |
|
haben wir binnen 2 Jahren
die Zahl der 20er in Hintersee mehr als verdoppelt und die ersten Zehn
bestehen |
|
|
| |
|
damit nur mehr mit Maxima
über diesem Schwellenwert. Alleine im März 2024 übersprangen wir ja zum |
|
|
| |
|
Monatsende hin die
20-Grad-Marke gleich 4-mal. Davor ereigneten sich in gut 2 Jahrzehnten
Messtätigkeit an |
|
|
| |
|
unserer Station lediglich
4 Zwanziger. Zwischen den 1960er und 90er Jahren waren es anhand der Daten
der |
|
|
| |
|
Hydrografischen Station
in Faistenau auch nur 5 zusätzliche Einträge. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Höchste Tagesmaxima im
März in Hintersee |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
31.03.2016 |
22,8 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
17.03.2017 |
22,8 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
30.03.2024 |
21,8 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4 |
20.03.2014 |
21,7 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5 |
27.03.2024 |
21,3 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
06.03.2025 |
21,3 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7 |
29.03.2024 |
20,6 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
8 |
31.03.2024 |
20,5 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
09.03.2025 |
20,5 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10 |
23.03.2023 |
20,3 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Frühester 20er um 2
Wochen vor verlegt |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit den 21,3 °C vom
Donnerstag gab es nicht nur einen der wärmsten Märztage, es schob sich auch
der |
|
|
| |
|
Zeitpunkt für den
Frühesten 20er im Tal von Faistenau und Hintersee gleich um 2 Wochen nach
vorne. Bisher |
|
|
| |
|
ereignete sich der
früheste 20er im Jahr am 20. März 2014 (21,7 °C). Zuvor musste man 24 Jahre
auf eine |
|
|
| |
|
Verbesserung warten.
1990 stellte sich der erste 20er am 22. März (20,3 °C) ein. 1977 war es mit
21,0 °C am 24. |
|
| |
|
März soweit. Zuvor
rutschten wir 1968 am 30. März mit 20 °C überhaupt erstmals in den März
hinein. Bis dahin |
|
|
| |
|
hieß es zumindest bis zum
6. April (1961 mit 21,4 °C) Zeit lassen. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Viel Geduld benötigte
man dagegen 1980, als es erst am 27. Mai (21,1 °C) die 20er-Premiere gab.
Recht lange |
|
| |
|
dauerte es ebenso 1974,
wo es am 19. Mai mit 22,1 °C soweit war. Eine ähnliche Wartefrist hatten noch
die |
|
|
| |
|
Jahre 1965 (23 °C am 17.
Mai) und 1979 (21,4 °C am 16. Mai). |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Seit den 1980er Jahren
sind derart späte erste 20er, die sich bis zur zweiten Maihälfte Zeit lassen,
nicht mehr |
|
|
| |
|
aufgetreten. Seit den
2000ern musste man auf den ersten 20er des Jahres nur noch einmal bis in den
Mai |
|
|
| |
|
warten. 2006 war es am 3.
Mai (21 °C) dann soweit. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Noch nie so zeitig im
Jahr so warm |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Das Auftreten einer so
ausgeprägten Wärmewelle, die an 5 Tagen hintereinander die 15-Grad-marke
übertraf, |
|
|
| |
|
war weder in unserer
Messreihe, noch in den Daten der Hydrografischen Station in Faistenau so früh
im Jahr, |
|
|
| |
|
nämlich Anfang März,
auffindbar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Das längste der Gefühle
in der heimischen Messreihe waren bis dato 4 Tage mit über 15 Grad vom 11.
Bis 14. |
|
|
| |
|
März 2002. Damals
bewegten sich die Höchstwerte zwischen 16 und 19 °C. Vom 12. Bis 14. März
2014 |
|
|
| |
|
überboten wir zumindest
noch 3 Tage am Stück die 15-Grad-Schwelle mit Maxima von 15,8 bis 16,3 °C. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Seit dem Beginn der
genauen Temperaturaufzeichnungen an unserer Station 2001 gab es in der
ersten |
|
|
| |
|
Märzhälfte ohnedies nur
18 Einträge, an denen es mehr als 15 °C hatte. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Noch karger sah es in den
4 Jahrzehnten zuvor aus. Hier waren sehr milde Tage mit über 15 °C in der
ersten |
|
|
| |
|
Märzhälfte maximal
Einzelereignisse, die im Schnitt alle 4 Jahre vorkamen (insgesamt 10
Einträge). |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die bisher früheste
Periode an 5 Tagen mit zumindest 15 °C gab es vom 15. Bis 19. März 1990. Die
Maxima |
|
|
| |
|
erreichten damals Werte
zwischen 15,8 und 19 °C. Eine zweite Phase dieser Dauer ereignete sich noch
vom 17. |
|
| |
|
Bis 21. März 1972 mit
Höchstwerten zwischen 15 und 16,5 °C. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: wetter.orf.at,
www.austrowetter.at, www.wetterzentrale.de |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagestemperaturen |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mo,
03.03.25 |
Rückblick
Februar: Sehr trocken und erneut zu mild |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 43 l/m² Niederschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 17,5 cm Neuschnee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 1,1 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 14,6 °C sechstwärmster
Februartag |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Februar 2025
untermauerte die seit der Herbstmitte vorherrschende Hochdruckdominanz in der
Witterung |
|
|
| |
|
und steigerte das damit
verbundene Niederschlagsdefizit, indem er zum trockensten Februar seit rund
4 |
|
|
| |
|
Jahrzehnten wurde. Es war
sehr sonnig, Regen und Schnee erlitten massive Einbußen. Dabei vermochte es
der |
|
|
| |
|
heurige Feber zumindest
über zwei Monatsdrittel mit etwas Frost und Mini-Schneefällen zur richtigen
Zeit ein |
|
|
| |
|
spätwinterliches Flair zu
behaupten und die dünne Schneedecke zu konservieren. Hinten hinaus brach
dieses |
|
|
| |
|
der Jahreszeit noch
entsprechende Konzept völlig zusammen und es wurde mit Temperaturen auf
Anfang-April- |
|
|
| |
|
Niveau frühlingshaft mild
und aper. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Im Februar dominierte in
der ersten Monatshälfte durchgehend Hochdruck. Dieser erstreckte sich zu
Beginn von |
|
|
| |
|
den Azoren bis
Skandinavien und wurde von Tiefs bei Grönland und Nordosteuropa flankiert.
Dabei etablierte |
|
|
| |
|
sich ein Hochkern über
Mitteleuropa, der während der ersten Februarwoche zum Baltikum abwanderte.
Damit |
|
|
| |
|
verlagerte sich auch die
Hochachse nordwärts und reichte nun von den Britischen Inseln bis
Nordwestrussland. |
|
|
| |
|
Ein, das baltische Hoch
umlaufender, Kaltlufttropfen vermochte keine Niederschläge zu bringen, als er
über dem |
|
|
| |
|
Alpenraum hinweg zog. Vor
der Monatsmitte stieß der Tiefdruck nach Island und sein Trog nach
Westeuropa |
|
|
| |
|
vor. Daraus löste sich
von Frankreich her ein weiteres kleines Tief, das nun den Alpenraum mit
etwas |
|
|
| |
|
Niederschlag beeinflussen
konnte. Im Anschluss blockte der nun von Grönland bis Westeuropa sich |
|
|
|
| |
|
ausdehnende Hochdruck den
Atlantik wieder erfolgreich ab. Dafür wurde an der Rückseite einer
Tiefdruckzone |
|
|
| |
|
über Nordwestrussland
neben kälterer Luft auch dezenter Störungseinfluss herbeigeführt. Nach
wenigen Tagen |
|
|
| |
|
drängte der sich von
Westen ausbreitende Hochdruck, der sich jetzt von Grönland bis zum Balkan
und |
|
|
| |
|
Nordafrika erstreckte,
den Tiefdruck bald vom Spielfeld. Dadurch drehte die Strömung von Nordost auf
Südwest, |
|
| |
|
sodass der kältesten
Phase im Monat eine zügige Milderung folgte. Mit einem Hochkern über dem
östlichen |
|
|
| |
|
Mitteleuropa stellte sich
am letzten Feberwochenende leichter Föhn ein, der vom Frontrest eines
Nordmeertiefs |
|
|
| |
|
beendet wurde. Doch
sogleich ging es auf die nächste äußerst milde Vorderseite eines Sturmtiefs
bei Island, das |
|
| |
|
vorerst gegen den
Hochdruck über Nord- und Osteuropa nicht ankam. Das Monatsende verlief
schlussendlich |
|
|
| |
|
doch unter zyklonalem
Einfluss wechselhaft und weiterhin mild. Nach der Front des Sturmtiefs zogen
ein |
|
|
| |
|
Randtief von Frankreich
her und ein Italientief ostwärts durch. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Stiefelzyklone
besserte zumindest im Süden Österreichs die sehr magere Niederschlagsbilanz
ein Stück auf. |
|
| |
|
Hier betrug das Defizit
bis zur Hälfte des Solls. Fast überhaupt nichts an Niederschlag gab es mit
Rückgängen |
|
|
| |
|
über vier Fünftel im
Nordosten und im Tiroler Oberland. Dazwischen lagen die Verluste zwischen der
Hälfte und |
|
|
| |
|
drei Viertel des
Üblichen. Bundesweit gemittelt setzte es mit einem Niederschlagsminus von 66
% den |
|
|
| |
|
trockensten Februar seit
2011. Zuvor war es 2003 und 1998 auch niederschlagsärmer gewesen. Nassester
Ort |
|
|
| |
|
war die Rudolfshütte mit
65 l/m². Dem entsprechend kläglich fiel selbst auf den Bergen die
Schneebilanz aus. Am |
|
| |
|
Feuerkogel (1.618 m)
schneite es im Februar nur 31 cm bei -68 % Abw. Und am Sonnblick (3.106 m) 79
cm bei – |
|
| |
|
62 % Abw. In den Tallagen
beliefen sich die Einbußen auf -87 %. Dafür war es in den Höhenlagen mit
einer |
|
|
| |
|
Abweichung von +2,2 °C
zum aktuellen Referenzmittel 1991-2020 ein ausgesprochen milder Feber (Platz
23). Im |
|
| |
|
Tiefland landete er mit
+1,0 °C Abw. Auf dem 45. Platz. Hierin gab es allerdings ein markantes
West-Ost-Gefälle. |
|
| |
|
Abgesehen von den
absoluten Niederungen war der Februar von Vorarlberg bis Salzburg und Kärnten
deutlich |
|
|
| |
|
zu mild.
Inversionsbedingt sah das in einem Bogen vom oberösterreichischen Zentralraum
bis in die Steiermark |
|
|
| |
|
anders aus. Hier pendelte
das Mittel um den langjährigen Schnitt. Im Vergleich zur Normalperiode
1961-90 |
|
|
| |
|
betrugen die Abweichungen
+1,9 bzw. +3,1 °C. Ähnlich verteilt waren die Sonnenstunden. Im Rheintal und
von |
|
|
| |
|
Osttirol bis ins südliche
Wiener Becken schien die Sonne teils um gut die Hälfte zu wenig. Entlang und
nördlich |
|
|
| |
|
des Alpenhauptkamms
lachte die Sonne zum Teil mehr als die Hälfte über dem Soll vom Himmel.
Österreichweit |
|
| |
|
lag die Sonnenscheindauer
um 8 % über dem Schnitt. Sonnenreichster Platz war der Brunnenkogel (Tirol)
mit |
|
|
| |
|
196 Stunden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
In Hintersee war der
Februar mit einer Niederschlagsmenge von 43 l/m² bei einem großen minus von
71 % der |
|
|
| |
|
trockenste Feber in
unserer Messreihe. Er unterbot die Februare 2011 (61 l/m²) und 2015 (60,5
l/m²) deutlich. |
|
|
| |
|
Größere negative
Abweichungen traten anhand der Daten der Hydrografischen Station in Faistenau
in einem |
|
|
| |
|
Februar zuletzt 1986 und
1982 auf. Diese waren jedoch um 4,5 bzw. 8,5 °C (!( kälter als der heurige
Februar. |
|
|
| |
|
Niederschlagsärmer als
diesmal war es ebenso in den Febern 1902, 1914, 1929, 1930, 1959, 1963, 1975
und im |
|
| |
|
trockensten Februar im
Tal von Faistenau und Hintersee, dem Februar 1976, mit gut 90 % Defizit. Den
Großteil |
|
|
| |
|
des Monatsniederschlags
gab es heuer mit 15 l/m² am 26. Februar. Es war einer von 8
Niederschlagstagen (-2 |
|
|
| |
|
Tage), die wenigsten seit
2018. Dagegen blieb es vom 18. Bis zum 23. Februar 6 Tage am Stück |
|
|
|
| |
|
niederschlagsfrei und vom
1. Bis zum 12. Sogar 12 Tage hintereinander trocken. Es war mit den 12 Tagen
vom |
|
|
| |
|
5. Bis 16. Februar 2023
die längste Periode, die ganz in einem Februar lag. Die längste
niederschlagsfreie |
|
|
| |
|
Phase, die zumindest
überwiegend in einem Februar stattfand, waren die 14 Tage vom 28. Jänner bis
zum 10. |
|
|
| |
|
Februar 2011. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Regenbilanz fiel mit
einer Summe von 23 l/m² bei einem Rückgang von 68 % ebenfalls sehr dürftig
aus. Es |
|
|
| |
|
war der fünftregenärmste
Februar der Messreihe. Letztmals weniger regnete es 2018 (17,5 l/m²). Der
Regen |
|
|
| |
|
verteilte sich dabei auf
5 Regentage (-2 Tage). Am meisten regnete es mit den erwähnten 15 l/m² am
26. |
|
|
| |
|
Februar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Noch düsterer sah es beim
Neuschnee aus. Mit gerade einmal 17,5 cm blieben wir heuer um 85 % unter
dem |
|
|
| |
|
langjährigen Schnitt.
Damit wiederholte sich nach den 16 cm aus dem Vorjahr ein extrem schneearmer
Februar. |
|
|
| |
|
Allein 2014 (15 cm),
2011 (15,5 cm) und 1998 (3 cm) gab es noch weniger Schnee. Die Zahl der
Schneefalltage |
|
| |
|
blieb mit 7 auch 4 unter
dem Soll. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dennoch hielt sich die
dünne Schneedecke über 22 Tage bis zum 22. Februar an unserer Station
geschlossen. |
|
|
| |
|
Talauswärts hatte es
jedoch schon früher auszuapern begonnen. Die maximale Schneehöhe erreichten
wir mit |
|
|
| |
|
23 cm am 17. Und 18.
Februar. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Temperaturen
verhielten sich in den ersten beiden Februardritteln mit einer markanten und
leichten positiven |
|
| |
|
Abweichung eher
unauffällig. Dies änderte sich im finalen Feberdrittel, das mit +4,6 °C Abw.
Den bisherigen |
|
|
| |
|
Rekord aus dem
Schlussdrittel 2021 um ein Zehntel Grad überbot. Nicht einmal im historisch
milden Februar |
|
|
| |
|
2024 war es im dritten
Monatsdrittel derart mild gewesen. In Summe ergab das ein Monatsmittel von
1,1 °C, |
|
|
| |
|
welches um 2,1 °C über
den Normal lag. Es war der mit 2021 geteilt sechstwärmste Februar in
unserer |
|
|
| |
|
Messreihe. Unter den 10
mildesten Febern liegen damit nur mehr Februare seit 2014. Seit 11 Jahren
tanzte |
|
|
| |
|
somit nur mehr der
Februar 2018 (Mittel: -3,6 °C) mit einem zu kalten Monatsmittel aus der
Erwärmungsreihe. |
|
|
| |
|
Wir zählten heuer 3
Eistage (-2 Tage), 18 Frosttage (-4 Tage) und 23 kalte Tage (-2 Tage). Die
tiefste |
|
|
| |
|
Temperatur des Monats
zeigte das Thermometer mit -9,6 °C am 19. Februar. Dafür sank das Minimum am
24. |
|
|
| |
|
Februar nur auf +3,5 °C,
was den neuntmildesten Tiefstwert eines Februartages bedeutete. Das
sechsthöchste |
|
|
| |
|
Maximum eines Febers
erzielten wir mit 14,6 °C am 25. Februar. Die 14,1 °C vom 22. Februar
schafften es |
|
|
| |
|
ebenso noch in die ersten
Zehn. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.geosphere.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Monatsrangliste Niederschl. |
>> Klimatage |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Tagestemperaturen |
>> Winterstatistik |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Schnee |
>> Monatsvergleich Temp. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sa,
01.03.25 |
Im
ehemaligen Schneeloch ist es zu warm |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
So titelten die
Salzburger Nachrichten einen Artikel in ihrer heutigen Lokalausgabe. Darin
befasste sich |
|
|
| |
|
Journalist Thomas
Auinger einerseits mit den niedrigen Pegelständen an den heimischen Seen, die
aufgrund der |
|
| |
|
anhaltenden
Niederschlagsarmut auftreten. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Als zweites Thema des
Artikels bezieht sich Auinger auf die Kernaussagen der unlängst hier
veröffentlichten |
|
|
| |
|
ausführlichen
Jahreszusammenfassung der Wetterstation Hintersee über das Wetterjahr 2024 in
Hintersee. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Vielen Dank an die SN für
das Interesse und das Aufgreifen der Arbeit über das vergangene Wetterjahr.! |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Den gesamten Bericht zum
Nachlesen gibt es unter dem folgenden Link. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Artikel: 01.03.25 Im
ehemaligen Schneeloch ist es zu warm |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sa,
01.02.25 |
Rückblick
Jänner: Sehr mild, sonnig und trocken |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 73 l/m² Niederschlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 33,5 cm Neuschnee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 0,3 °C mittlere
Temperatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
+ 10,9 °C Tageshöchstwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Auftakt in das neue
Jahr 2025 verlief im Jänner mit unaufgeregtem Wetter. Die zunehmende |
|
|
|
| |
|
Hochdruckdominanz der
Vormonate legte im beginnenden 2025 noch ein Stück zu und hielt
frontales |
|
|
| |
|
Geschehen meist
erfolgreich von uns ab. Der Jänner zeigte sich regen- und schneearm,
vermochte aber die |
|
|
| |
|
dünne Schneedecke trotz
viel Milde gut zu konservieren. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Das neue Jahr 2025 begann
noch unter dem sich zu Weihnachten eingestellten Hochdruckwetter. Das |
|
|
| |
|
Hochzentrum war jedoch
bereits südostwärts aus Mitteleuropa abgezogen und ein Islandtief brachte
eine |
|
|
| |
|
schwache Störung in den
ersten Jännertagen. Gefolgt wurde dies durch eine recht milde Südwestströmung
an |
|
|
| |
|
der Vorderseite von Tiefs
bei Irland und der Bretagne. Letztere schob eine markante Kaltfront in den
Alpenraum, |
|
|
| |
|
welche im Osten
Österreichs für Orkan auf den Bergen sorgte. Nach Abzug des Tiefs zum
Baltikum und |
|
|
| |
|
abklingendem
Rückseitenwetter übernahm mit Schwenk in die zweite Jännerdekade erneut
Hochdruck von |
|
|
| |
|
Westen her das Kommando.
Ein kräftiges Hoch schob sich dabei von den Britischen Inseln nach
Mitteleuropa, |
|
|
| |
|
wo es zur Monatsmitte
noch einen kurzen Streifschuss eines Tiefs bei Nordwestrussland zuließ.
Danach festigte |
|
|
| |
|
sich der langsam nach
Osteuropa wandernde Hochdruck erneut und eine ausgeprägte Inversionslage mit
satter |
|
|
| |
|
Höhenmilde und frostigen
Niederungen trat auf. Zu dieser Zeit umkreisten Tiefs in weitem Abstand und
in einem |
|
|
| |
|
Bogen vom europäischen
Nordmeer über Nordost- und Südosteuropa bis zum Mittelmeerraum den
Kontinent. |
|
|
| |
|
Erst zur Mitte der
dritten Jännerdekade konnte ein mächtiges Tief vor Irland, das den Britischen
Inseln einen |
|
|
| |
|
schweren Orkan brachte,
das Hochbollwerk zurückdrängen. Mit einem weiteren Orkantief sowie einem |
|
|
| |
|
Ablegertief im
Mittelmeerraum verirrten sich wieder schwache Fronten in unsere Richtung. Die
letzten |
|
|
| |
|
Jännertage gingen unter
sich vom Ostatlantik her ausdehnenden Hochdruck antizyklonal geprägt ins
Land. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die oftmaligen
Hochdrucklagen samt inversiver Temperaturumkehr sowie sehr milde Höhenluft
bzw. |
|
|
|
| |
|
Föhneinschübe
hinterließen in Österreich differierende Monatsmitteltemperaturen. Der Jänner
war dennoch in |
|
|
| |
|
allen Regionen zu mild.
Weniger unter viel Hochnebel im Kaltluftsee, mehr in mittleren Höhenlagen
oder im |
|
|
| |
|
Südosten. Flächig
gemittelt betrug die Abweichung herunten +1,5 °C zur Klimanormalperiode
1991-2020 bzw. |
|
|
| |
|
+3,0 °C zum
Referenzzeitraum 1961-90. Auf den Bergen wichen die Mittelwerte um 1,6 bzw.
2,9 °C nach oben |
|
|
| |
|
ab. Es war einer der 25
wärmsten Jänner in Österreich. Die Niederschlagsbilanz sah vor allem an
der |
|
|
| |
|
Alpennordseite von
Salzburg ostwärts mit Rückgängen zwischen einem und drei Viertel mager aus.
Lokal war es |
|
| |
|
in Niederösterreich noch
deutlich trockener. Relativ ausgeglichen zeigte sich der äußerste Westen und
die |
|
|
| |
|
Regionen von Osttirol bis
ins Südburgenland. Im Kärntner Südstau gab es lokale Zugewinne von der
doppelten |
|
|
| |
|
bis zur dreifachen Menge.
Federführend war hier der Loiblpass (Kärnten) mit 298 l/m² als nassester
Ort |
|
|
| |
|
Österreichs,
hauptsächlich beruhend auf ein Italientief am Jännerende. Bundesweit gab es
um 23 % weniger |
|
|
| |
|
Niederschlag als üblich.
Die Sonne schien im Jänner um 4 % länger als im langjährigen Schnitt. Es gab
aber |
|
|
| |
|
große regionale
Unterschiede. Die außeralpinen Hochnebelsenken blieben eher trüb, die Berge
sehr sonnig. |
|
|
| |
|
Einbußen bis zur Hälfte
des Solls gab es im Nordosten, bis zu einem Drittel weniger im Osten und
Südosten. Bis |
|
| |
|
zu einem Drittel mehr an
Sonne verzeichnete die Mitte Österreichs in einem Kreis vom Innviertel über
das Tiroler |
|
|
| |
|
Unterland, Unterkärnten
bis zur Obersteiermark. Sonnigster Fleck war die Stolzalpe (Steiermark) mit
145 |
|
|
| |
|
Sonnenstunden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die wohl auffälligste
Abwesenheit lieferte in Hintersee der Neuschnee. Im Jänner summierten sich
schwache |
|
|
| |
|
33,5 cm, was ein minus
von 73 % bedeutete. Damit zählte der heurige Jänner zum schneeärmsten
Viertel |
|
|
| |
|
unserer Messreihe.
Letztmals weniger Schnee in einem Jänner gab es 2008. Damals gab es auch
zuletzt eine |
|
|
| |
|
gleich geringe Anzahl an
Schneefalltagen, die mit 8 um 4 Tage unter Schnitt lag. Die größte
tagesmenge |
|
|
| |
|
schneite es mit 16 cm am
3. Jänner, also schon die halbe Monatsmenge. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Dennoch hielt sich die
Schneedecke auf recht niedrigem Niveau an unserer Station den ganzen Monat
über |
|
|
| |
|
geschlossen. Ihren
Höchststand wies sie ebenfalls am 3. Jänner mit 38 cm auf. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit -80 % noch größer war
der Rückgang beim Regen. An 5 Regentagen (-2 Tage) akkumulierten sich nur
16 |
|
|
| |
|
l/m². Hinter 1997, 2006,
2009 und 2010 war es der regenärmste Jänner unserer Messreihe. Mit der
halben |
|
|
| |
|
Monatsmenge von 8 l/m²
regnete es am 23. Jänner die größte Tagessumme. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Niederschlagsbilanz
gab mit einer Menge von gesamt 73 l/m² bei -70 % nicht viel her. Wir hatten
den |
|
|
| |
|
trockensten Jänner seit
2009. Den meisten Tagesniederschlag gab es mit 15 l/m² am 3. Jänner. Wir
zählten 10 |
|
|
| |
|
Niederschlagstage (-8
Tage). Vom 17. Bis zum 22. Jänner blieb es 6 Tage hintereinander
niederschlagsfrei. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ein kurzes Zwischenfazit
des Winters 2024/25 verdeutlicht uns die grassierende Schneearmut. Bis Ende
Jänner |
|
|
| |
|
schneite es magere 121,5
cm. Für die erste Winterhälfte war das der schwächste Start seit dem Winter
1989/90. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Was dem Jänner allerdings
nicht fehlte, waren hohe Temperaturen. Mit einem Monatsmittel von 0,3 °C bei
einer |
|
|
| |
|
Abweichung von +2,5 °C
war es der viertwärmste Jänner unserer Messgeschichte. Geschlagen nur von
2018 |
|
|
| |
|
(Mittel: 1,3 °C) sowie
2014 und 2023 (Mittel: 0,8 °C). Dabei war es vor allem in der dritten
Jännerdekade mit +4,6 |
|
| |
|
°C Abweichung rekordwarm,
nachdem es erst im Vorjahr eine neue Bestmarke gegeben hatte. Das
Mitteldrittel |
|
|
| |
|
war leicht über Schnitt
temperiert, das Startdrittel wiederum viel zu mild. Wir verzeichneten 5
Eistage (-7 Tage), |
|
|
| |
|
22 Frosttage (-4 Tage)
und 30 kalte Tage (-1 tag). Am höchsten stieg die Temperatur mit 10,9 °C am
19. Jänner, |
|
| |
|
dem sechsthöchsten Wert
eines Jännertages. Am tiefsten sank das Thermometer mit -8,3 °C am 14.
Jänner. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quelle: www.zamg.ac.at |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagesniederschläge |
>> Monatsrangliste Niederschl. |
>> Klimatage |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Regen |
>> Tagestemperaturen |
>> Winterstatistik |
|
| |
|
|
>> Monatsvergleich Schnee |
>> Monatsvergleich Temp. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Fr,
31.01.25 |
Das
Wetterjahr 2024 - Wenn ein Bergdorf das Stadtklima überholt |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Das abgelaufene
Wetterjahr 2024 war der bisherige Höhepunkt einer Wärmeanomalie, die seit dem
Oktober |
|
|
| |
|
2022 auftrat und
teilweise für regelrecht epochale Rekorde verantwortlich zeichnete. Alleine
2024 erzielten wir an |
|
| |
|
unserer Wetterstation in
Hintersee 3 neue Monatsbestmarken. In einem etwas überdurchschnittlich nassen
und |
|
|
| |
|
sehr schneearmen Jahr
ging die Jahresmitteltemperatur in ungeahnte Höhen. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Es gab um ein Neuntel
mehr Regen an 170 Regentagen und dafür um fast 60 % weniger Schnee an 51 |
|
|
| |
|
Schneefalltagen. Die Zahl
der Schneedeckentage im Winter 2023/24 brach auf ein Rekordtief ein.
Genauso |
|
|
| |
|
verhielt es sich bei der
Kälte. Im Kalenderjahr fehlten drei Wochen Dauerfrost und sieben Wochen, an
denen die |
|
|
| |
|
Minima unter den
Gefrierpunkt sanken. Dagegen war die Zahl der Sommertage um ein Drittel
höher. Wir zählten |
|
|
| |
|
45 Gewitter, wovon 5 mit
Hagel verbunden waren. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mit einem Jahresmittel
von 8,8 °C bei einer Abweichung von +2,0 °C übertrafen wir den erst 2023
aufgestellten |
|
|
| |
|
Rekord gleich wieder um
vier Zehntel Grad. In Hintersee war es damit 2024 um 0,7 °C wärmer als in
der |
|
|
| |
|
Referenzperiode 1961-90
in der Stadt Salzburg. Im Vergleich zum vorindustriellen Stadtmittel
1851-1900 lag |
|
|
| |
|
unser Jahresmittel 2024
sogar um 1,5 °C darüber. Vor dem zunehmenden Anstieg der Temperaturen seit
den |
|
|
| |
|
späten 1980er Jahren war
es in der Stadt Salzburg 1846, 1862, 1863, 1868, 1872, 1934, 1950 und 1967
etwas |
|
|
| |
|
wärmer als 2024 in
Hintersee. Das Stadtklima des 19. Jahrhunderts ist somit bereits über das
Hinterseer talniveau |
|
| |
|
hinaus geklettert. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2024 begann im Jänner
sehr mild und zur Monatsmitte mit einer winterlichen und mäßig kalten Phase.
AB dem |
|
|
| |
|
letzten Jännerdrittel
setzte eine extrem warme Periode ein, die bis Mitte April andauerte. Der
Februar war wohl |
|
|
| |
|
der wärmste seit dem 16.
Jahrhundert und auch der März stieß in historisch warme Dimensionen vor. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Zur Osterzeit, beim
Monatswechsel März auf April, trübte zwar viel Saharastaub die Luft, dennoch
stellte sich mit |
|
|
| |
|
5 20ern in 6 Tagen eine
außergewöhnliche Wärmephase ein. Diese mündete Am 7. April mit dem
frühesten |
|
|
| |
|
Sommertag in unserer
Messreihe. 2023 mussten wir auf diesen bis zum 18. Juni warten. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Winter hatte zu
dieser Zeit keine Chance und traute sich erst in der zweiten Aprilhälfte auf
ein kurzes |
|
|
| |
|
Gastspiel zurück. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Im Mai schritt der
wärmste Frühling der Messreihe wechselhaft und warm mit ersten richtigen
Gewittern dahin. |
|
|
| |
|
Auch der Juni vermochte
zuerst nicht viel daran zu ändern, gab aber schließlich den Startschuss in
den Sommer |
|
|
| |
|
mit dem heißesten Tag des
Jahres Am 29. Juni. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Juli und August verliefen
hochsommerlich warm. In der oftmals schwülen Luft kam es wiederholt zu
Gewittern. |
|
|
| |
|
Ein markantes Hagelwetter
ging Am 1. September nieder, weil es zu Anfang des Herbstes weiterhin |
|
|
|
| |
|
hochsommerlich blieb. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Das herausragende
Wetterereignis des Jahres trat Mitte September auf. Der Nordosten Österreichs
wurde von |
|
|
| |
|
einer schweren
Hochwasserkatastrophe getroffen. Im Südosten blies der Sturm, in den Alpen
gab es massig |
|
|
| |
|
Neuschnee. In Hintersee
regnete, schneeregnete und schneite es Am 14. September 113 l/m². Auf den
Bergen |
|
|
| |
|
gab es einen massiven
Wintereinbruch. Der September brachte in unserer Gemeinde einen Monatsrekord.
Zum |
|
|
| |
|
vierten Mal knackten wir
neben dem Juli 1997 sowie den Jännern 2012 und 2019 die 500-Liter-Marke. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der weitere Herbst
brachte zusehends von Hochdruck dominiertes Wetter. Dabei gelang es dem
Oktober zum |
|
|
| |
|
dritten Mal in Folge den
bis 2021 gültigen Temperaturrekord deutlich zu überbieten. Im Übergang zum
November |
|
| |
|
blieb es an 20 Tagen
hintereinander niederschlagsfrei. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die letzten Wochen im
Jahr 2024 gestalteten sich leicht wechselhaft, eher trocken und nicht mehr so
exorbitant |
|
|
| |
|
warm. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Den ganzen Jahresbericht
über das Wetterjahr 2024 mit ausführlichen Beschreibungen der
Großwetterlagen, |
|
|
| |
|
detaillierten
Ereignisberichten sowie Daten und Fakten gibt es unter dem folgenden Link. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Das Wetterjahr 2024 - Wenn
ein Bergdorf das Stadtklima überholt |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
So,
19.01.25 |
Höhenmilde
im Hochwinter |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die in den letzten Tagen
aufgebaute Inversionslage mit der bekannten Temperaturumkehr zwischen
kalten |
|
|
| |
|
Niederungen und milden
Höhenlagen erreichte am heutigen Sonntag ihren Höhepunkt. Vor allem in
Lagen |
|
|
| |
|
zwischen 700 und 1.200 m
wurde es dabei ausgesprochen mild für die Jahreszeit und man konnte von
einem |
|
|
| |
|
Vorfrühlingstag inmitten
des herrschenden Hochwinters sprechen. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Hochdruck über
Mitteleuropa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Das dominierende
Hochdruckgebiet „Beate“ verlagerte sich in den letzten Tagen mit seinem
Zentrum von West- |
|
|
| |
|
nach Mitteleuropa. Dabei
bot es in mittleren Höhenlagen zusehends mildere Luftmassen auf, während sich
in |
|
|
| |
|
den windgeschützten
Niederungen Kaltluftseen ausbildeten. Darüber breiteten sich mehr oder
weniger zähe |
|
|
| |
|
Hochnebelfelder aus,
während abseits davon und auf den bergen die Sonne ihr astronomisches
Maximum |
|
|
| |
|
ausschöpfte und von einem
wolkenlosen Himmel strahlte. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
An diesem Wochenende
wanderte das Hoch schließlich noch ein Stück weiter ostwärts, um mit seinem
Kern |
|
|
| |
|
über dem östlichen
Mitteleuropa anzukommen. Dadurch drehte die schwache Höhenströmung auf
eine |
|
|
| |
|
südöstliche Richtung und
es wurde ein Schwall sehr milder Luft herbeigeführt. Diese sorgte mit
leichten |
|
|
| |
|
Föhneffekten für einen
sehr milden Jännertag. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Sechstwärmster Jännertag
in Hintersee |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Nach einem frostigen
Start in den Samstag gelangte auch Hintersee in den Zustrom der milden
Luftmasse. Die |
|
|
| |
|
Nacht auf Sonntag verlief
frostfrei und am Vormittag begann eine weitere Erwärmung. Mit dem
Sonnenschein |
|
|
| |
|
und zarten Südföhn
kletterte das Thermometer an unserer Station schlussendlich bis auf 10,9 °C,
was den |
|
|
| |
|
sechsthöchsten Wert für
einen Jännertag bedeutete. Das Minimum wurde bereits um Mitternacht mit 0,9
°C |
|
|
| |
|
erreicht. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Wir verfehlten den
Jännerrekord um ein knappes Grad, dieser wird nach wie vor mit 11,8 °C vom
19. Jänner |
|
|
| |
|
2014 gehalten. Auf Rang 2
liegt der 24. Jänner 2024 mit 11,6 °C vor dem 29. Und 30. Jänner 2002 mit
11,5 °C |
|
|
| |
|
und dem 10. Jänner 2015
mit 11,2 °C. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Abtenau wärmster Ort
Österreichs |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Die Wärmekrone ging heute
ins Lammertal nach Abtenau. Mit frühlingshaften 15,4 °C war es dort
österreichweit |
|
|
| |
|
am mildesten. Am 2. Platz
folgte Windischgarsten mit 14,6 °C vor Pabneukirchen mit 13,0 °C (beide |
|
|
|
| |
|
Oberösterreich). Rang 4
ging an Ehrwald mit 12,6 °C (Tirol) vor Mittelberg und Schröcken mit jeweils
12,1 °C |
|
|
| |
|
(beide Vorarlberg). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Vorfrühling in Salzburg |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Abtenau auf 711 m war
natürlich auch in Salzburg der wärmste Ort. Neben den offiziellen Stationen
der |
|
|
| |
|
staatlichen Wetterdienste
erzielten zudem Messstellen des Hydrografischen Dienstes Salzburg
beachtliche |
|
|
| |
|
Werte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ex aequo mit Abtenau
schaffte es die Station am Kobenzl/Gaisberg (737 m) auf 15,4 °C. Den 2. Rang
eroberte |
|
|
| |
|
St. Koloman (1.000 m) mit
13,7 °C vor Bad Dürrnberg (778 m) mit 12,3 °C. Auf der Buttermilchalm in St.
Martin |
|
|
| |
|
am Tennengebirge (1.120
m) stieg das Thermometer auf 10,2 °C, auf der Postalm (1.170 m) auf 9,7 °C.
In |
|
|
| |
|
Fuschl (670 m) wurde es
mit 9,9 °C fast zweistellig und in Faistenau (727 m) kletterte das
Quecksilber auf 9,4 |
|
|
| |
|
°C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Bei den offiziellen
Stationen am zweitmildesten war es am Kolomansberg (1.114 m) mit 10 °C. Hier
blieb es bei |
|
|
| |
|
einem Minimum von 6,2 °C
durchgehend sehr mild. Dem entgegengesetzt stieg die Temperatur in |
|
|
|
| |
|
Salzburg/Freisaal (420 m)
von -5,3 auf 9,6 °C und in St. Veit von -4 auf 9 °C an. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der einzige Ort mit
Dauerfrost fand sich im Lungauer Eisschrank. In St. Michael (1.050 m) gab es
einen |
|
|
| |
|
Tagesgang von -12,6 auf
-0,8 °C. In Tamsweg (1.022 m) ging es von -12,7 auf 1,8 °C ebenso leicht ins
Plus wie |
|
|
| |
|
in Mariapfarr (1.151 m)
von -12,7 auf 3,6 °C. Verhältnismäßig frisch blieb es auch ganz im Norden
des |
|
|
| |
|
Flachgaus. In Mattsee
(505 m) legten die Temperaturen nur von -4,5 auf 3,3 °C zu. |
|
|
|
|
| |
Copyright © by Franz Kloiber,
Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at,
office@wetter-hintersee.at |
|
|
|
| |
|
Abgesehen vom Lungau
musste man Dauerfrost schon im Hochgebirge suchen. Am Sonnblick (3.105
m) |
|
|
| |
|
bewegten sich die
Temperaturen zwischen -7,9 und -6,7 °C. Selbst auf der Rudolfshütte (2.304 m)
ging es von – |
|
|
| |
|
4,2 auf 0,4 °C. Tauwetter
herrschte dann bereits auf der Schmittenhöhe (1.973 m) mit Werten zwischen
1,4 und |
|
|
| |
|
4 °C. Ziemlich mild
zeigte sich das Mittelgebirge mit Werten von 5,2 bis 8,6 °C auf der Loferer
Alm (1.623 m) |
|
|
| |
|
sowie von 4,4 bis 8,2 °C
am benachbarten Feuerkogel (1.618 m) bei Bad Ischl. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Quellen: wetter.orf.at,
www.austrowetter.at, www.salzburg.gv.at |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Tagestemperaturen |
>> Schönwetterperioden |
>> Monatsvergleich Temp. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Mi,
01.01.25 |
Feuerwerk
in klarer Winternacht |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
PROSIT 2025! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ruhiges Winterwetter mit
viel Sonnenschein hatte sich seit den Weihnachtsfeiertagen bei uns in
Hintersee |
|
|
| |
|
eingestellt.
Meteorologisch ereignislos nahte damit der Jahreswechsel, wo es bekanntlich
nicht ganz so still von |
|
|
| |
|
statten geht. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Der Schwenk in das neue
Jahr präsentierte sich mit einer dünnen Schneedecke von 24 cm an unserer
Station |
|
|
| |
|
und einer klaren
Silvesternacht. Um Mitternacht leuchteten neben den Feuerwerksraketen über
dem Dorf auch |
|
|
| |
|
die Sterne bei leichten
Frost von -0,2 °C. Deutlich milder hatten es da etwaige Feiernde auf den
Almhütten, da es |
|
| |
|
in rund 1.100 m +8 °C
hatte (Kolomansberg). |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Folgend wie gewohnt
einige Eindrücke des Feuerwerks über der Ladenbachmetropole. Die
Wetterstation |
|
|
| |
|
Hintersee wünscht ein
gutes neues Jahr! |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Links: |
>> Fotoalbum: 01.01.25 Feuerwerk
in klarer Winternacht |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|